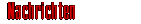

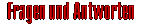



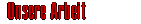




EXPERIMENT AN LEBENDEN MENSCHEN
«SULEIKA öffnet die Augen» ‒ unter diesem Titel sah das Land im Frühjahr dieses Jahres einen Film nach dem Roman von Jachnina: in den 1930er Jahren werden Sondersiedler über die Angara transportiert und am öden Ufer in der tiefsten Taiga ausgesetzt. Die der Willkür des Schicksals ausgelieferten Menschen waren gezwungen, sich Erd-Höhlen zu graben und sich in der Taiga etwas Essbares zu beschaffen. Diejenigen, die in jenem schrecklichen Winter überlebten, errichten an dieser Stelle eine Siedlung.
Ein ähnliches «Experiment» an lebendigen Menschen erfuhr auch die Einwohnerin der Ortschaft Tscherjomuschki im Karatussker Bezirk, Lydia Philippowna Gelgorn (Gelhorn) mit ihren Eltern, Brüdern und dutzenden anderen Menschen am eigenen Leib. Nur geschah es mit ihnen 1942 am Jenissei.
Die Familie ihrer Eltern lebte vor der Aussiedlung in der Stadt Jekaterinintal (Katharinenthal) im Gebiet Saratow. Vater Philipp Philippowitsch Gelgorn arbeitete als Buchhalter ‒ zu der damaligen Zeit kein geringfügiger Posten. Die Mutter, Lydia Karlowna, konnte ebenfalls lesen und schreiben. Beide konnten Russisch. Sie zogen sechs Kinder groß. Die stalinistische Deportation beendete das Leben am Heimatort auch für diese Familie – und für eine weitere halbe Million Einwohner der Wolga-Republik, deren einzige Schuld darin bestand, dass sie deutsche Nachnamen trugen.
In Sibirien gerieten die Gelgorns zunächst nach Kansk, ein Jahr später wurden sie mit einem Lastkahn den Jenissei flussabwärts geschickt. Richtung Norden. Unterwegs wurden die Menschen aufgeteilt und am Ufer ausgesetzt. Als Lydia Philippownas Familie an die Reihe kam, war es später Abend. Am Ufer stand nur ein einziges Gebäude ‒ die Hütte der Bojen-Wärterin. Als sie den Lärm hörte, kam sie aus ihrem winzigen armseligen Bau gerannt und fing an zu schreien, dass es hier niemanden und nichts gäbe. Doch der Lastkahn hatte bereits wieder abgelegt. Am leeren Ufer blieben 260 Menschen zurück.
Schnell wurde es dunkel, Schneeregen kam auf. Die Menschen besaßen keine Lebensmittelvorräte und keine warme Kleidung. Durchgefroren von dem nassen Schnee und hungrig warteten sie mehrere Tage auf Hilfe. Sie versuchten alles zu essen, was sie in der umliegenden Taiga fanden. Aber was kann man dort schon im Spätherbst unter dem Schnee finden? Im Norden beginnt der Winter bereits im September. Sie eilten jedes Mal zum Wasser, wenn irgendein kleines Schiffchen vorbeifuhr, aber niemand schenkte ihnen Aufmerksamkeit. Erst am vierten Tag kam ein Kutter heran, um zu erfahren, woher an diesem öden Ort plötzlich Menschen kamen. Und nachdem sie es erfahren hatten, fanden sie jemanden, dem sie von den unglücklichen Verlassenen erzählen konnten.
Ein paar Tage später legte ein Kutter bei ihnen an, der Brot mitgebracht hatte. Es wurde sofort verteilt und aufgegessen. Nach ungefähr einer weiteren Woche kam eine Barke mit Holz und Lebensmitteln. Mehrere Männer kamen an Land. Sie blieben bei den Sonderumsiedlern, um ihnen beim Bau von Baracken behilflich zu sein, ihnen das Jagen und Fische fangen beizubringen. Überall herrschte bereits der Polarwinter, und man brauchte dringend ein Dach über dem Kopf. Die Minderjährigen angelten Fische für den Gemeinschaftskochtopf, fingen Vögel und Hasen. Aus dem Hasenfell fertigten sie primitives Schuhwerk, aus den Häuten lernten sie Mützen und Fäustlinge zu nähen. Aber das war katastrophal wenig. Die Menschen erstarrten vor Kälte und der im Herbst herangebrachte Lebensmittelvorrat reichte nicht lange. Der erste Winter erwies sich als verhängnisvoller Hunger-Winter. Viele starben. «Wir wären dort alle umgekommen, ‒ erinnert sich Lydia Philippowna jetzt, ‒ aber zu unserem Glück fror eine Barke im Eis fest, die es nicht rechtzeitig zu ihrer Überwinterungsstelle geschafft hatte. Sie hatte Lebensmittel geladen. Dorthin schickte man Gefangene, um die Lebensmittel ans Ufer umzuladen. Sie übernachteten zusammen mit uns».
Die Bewohner der Baracke bekamen auch etwas zu essen. Das war die Rettung. Der Ausbau der Siedlung wurde fortgesetzt. Aus irgendeinem Grund nannte man sie Deneschnij (geldlich; Anm. d. Übers.). Es wurde eine Genossenschaft gegründet, zu dessen Vorsitzenden man, weil er am besten lesen und schreiben konnte, Lydia Philippownas Vater ernannte, doch schon kurze Zeit später wurde er wegen angeblicher Schädlingstätigkeit eingesperrt: die Fischer-Mädchen hatten das Netz nicht rechtzeitig aus dem Wasser gezogen und es war im Eis eingefroren.
Als der Vater 1945 zurückkehrte, holte man ihn sofort als Buchhalter in einen nahegelegenen Betrieb, wo Freie lebten. Das Leben wurde ein klein wenig leichter. Lydia Philippowna besuchte dort die Schule, und heiratete, als sie herangewachsen war, den russischen Burschen Viktor Tschugunekow. Als 1956 die Aufsicht über die Verbannten aufgehoben wurde und die Kommandantur aufhörte zu existieren, halfen Viktors Freunde der Familie Gelgorn-Tschugunekow beim Umzug in den Süden der Region. In der tscherjomuschkinsker Sowchose des Karatussker Bezirks wurde ein Buchhalter benötigt. Dort bekam Lydias Vater Arbeit.
Die Mitglieder dieser Familie hatten mehr Glück als andere: der geforderte Berufsfachbereich und die Kenntnis der russischen Sprache halfen ihnen dabei, sich schneller an die Ansiedlung in einem fremdsprachigen Umfeld anzupassen. Die meisten ihrer Landsleute von der Wolga hatten es viel schwerer. Und aus unterschiedlichen Gründen waren auch nicht alle bestrebt, sich die russische Sprache anzueignen.
Aus Kriegsbüchern und -filmen wissen wir, dass die Faschisten, welche die Slawen nicht für Menschen hielten, gefangene Frauen zwangen, sich splitternackt auszuziehen. Sie konnten auch selbst vor ihnen in obszöner Weise auftreten, wenn sie ihre Häuser in den besetzten Dörfern einnahmen. Aber die Einwohnerin der Ortschaft Sagaisk, Minna Augustowna Kurpas, erinnert sich, dass ein russischer Begleitsoldat in der gleichen Weise mit ihrer Mutter Jelena Augustowna Schmidt umging ‒ und bei ihr war ein kleines Mädchen.
Das war im Spätherbst des Jahres 1941 im Norden der Region Krasnojarsk, in Jarzewo, wohin man sie gewaltsam aus dem Wolgagebiet umgesiedelt hatte. Man brachte sie auf dem Jenissei dorthin und ließ sie dann zurück. Lasst euch nieder, wo immer ihr wollt. In aller Eile mussten sie sich Erd-Hütten graben. Im ersten Winter wurde das für sie zur Wohnung und zum Badezimmer.
Einmal erhitzten sie zusammen mit Mama Wasser und begannen sich zu waschen, als der örtliche Begleitsoldat zu ihnen herantrat, der die Verbannten im Auge behalten sollte. «Mama und ich standen nackt da, schließlich wuschen wir uns ja, ‒ erzählte die Frau, ‒ und er gibt uns irgendein Kommando. Na, Mama warf ihm irgendeine scharfe Antwort auf Deutsch zu. Daraufhin versetzt er ihr mit aller Kraft einen Schlag mit der Peitsche. Die Peitsche hielt er in der Hand. Ich fing an zu weinen, warf mich an Mamas Hals, und blieb dort hängen, aber trotzdem schlug er immer wieder auf uns beide ein. Dabei schrie er erbittert: «Du sollst Russisch reden! Du sollst Russisch reden!».
Lebenslänglich konnte ihre Mutter, die stolz darauf war Deutsche zu sein, die Demütigung nicht vergessen, der sie in Jarzewo durch den russischen Wachmann ausgesetzt gewesen war. Sobald sie die Erlaubnis erhielten, verließen sie den Ort und machten sich auf die Suche nach ihren Angehörigen, die während der Deportation in der gesamten Region Krasnojarsk verstreut worden waren. In Sagaisk machten sie Mamas Schwester Kristina Augustowna ausfindig (Ehename Schwabenland). Dorthin zogen sie um. Die inzwischen herangewachsene Minna ging als Melkerin in die Kolchose. Sie heiratete. Zog einen Sohn groß. Ihr Arbeitsleben in der Kolchose betrug 26 Jahre. Und alles schien in der Folge gut zu laufen. Sie gewöhnte sich ins russischsprachige Umfeld ein. Aber ihre Mutter lehnte es kategorisch ab Russisch zu lernen. Sie wollte in dieser Sprache nicht sprechen. Jener Vorfall mit dem gemeinen Kommandanten hatte ihre Selle bis zu ihrem Ende verbrannt.
Viele Jahre sind seitdem vergangen. Die Mama ist schon lange tot. Minna selbst ist inzwischen auch schon betagt, aber sobald sie sich daran erinnert, ist es, als ob ihr Körper erneut anfängt vom Schlag der Wachsoldaten-Peitsche zu brennenà.
Mitunter hört man die Leute murren: «Wozu sich an die Vergangenheit erinnern? Was ändert sich denn dadurch? Die deportierten Deutschen wurden faktisch vor dem Untergang an der Front bewahrt; dafür sollten sie doch dankbar sein».
Vielleicht wird der Bericht der Einwohnerin von Sagaisk, Emma Nikolajewna Schwabenland (Mädchenname Staitz) diejenigen eines Besseren belehren, die davon überzeugt sind, dass man die dunklen Seiten der Geschichte nicht wieder ausgraben muss?
Emma Nikolajewna selbst wurde 1956 bereits in Sibirien geboren, an der Goldmine Wjerchnij Amyl, im Karatussker Bezirk. Wie die Umsiedler dort den ersten Winter überstanden, hat sie aus Berichten ihrer Schwiegermutter Therese Petrowna Schwabenland erfahren, die als Heranwachsende vom Ufer der Wolga deportiert wurde. Sie hatte ein sehr gutes Verhältnis zur Schwiegermutter, und die teilte mit ihrer Schwiegertochter alles, was ihr auf der Seele lag.
Als Therese 16 Jahre alt wurde, schickte man sie in die Arbeitsarmee. Dort wurde sie von Unglück und Elend heimgesucht. Wie schlimm es auch gewesen sein mochte, einen ganzen Monat lang von der Wolga aus in Viehwaggons unterwegs zu sein, wie sehr sie auch im ersten Winter an der Goldmine Hunger gelitten hatten, aber in der Arbeitsarmee war es noch hundertmal schlimmer. In den Baracken eisige Kälte, riesige Risse in den Wänden, von der Decke rann der Regen herab. Im Winter gefror alles, die ganzen Wände waren mit Eis bedeckt. Tagsüber Arbeiten unter freiem Himmel, bei schlechtem Wetter wurde die Kleidung völlig durchnässt, und es gab keine Stelle, wo man sie hätte trocknen können. Theresa trocknete sie mit dem eigenen Körper, indem sie sich in der Nacht darauflegte. As ihre Rettung erwiesen sich Steppdecken, die ihre Mutter ihr noch hatte mitgeben können. Die Arbeit war für die junge Frau höllisch schwer, und zu essen bekamen sie Sauerampfer-Suppe mit einem kleinen Stückchen Brot. Viele hielten dem nicht stand. Jeden Morgen wurden mehrere Leichen aus der Baracke hinausgetragen. Und Theresa legte sich schlafen, in der Hoffnung, dass sie im Schlaf sterben würde, um diesem Leid ein Ende zu bereiten. Doch der Tod hatte kein Erbarmen mit ihr.
‒ Das war ein richtiges Konzentrationslager, und wir – richtige Gefangene, ‒ erzählte sie, nachdem sie nach Hause zurückgekehrt war.
Die Grausamkeit in Bezug auf die kleinen Kinder lässt sich kaum mit der Kriegszeit rechtfertigen. Aber solche Fälle verfolgten die Deportierten auf Schritt und Tritt. In die Arbeitsarmee wurden nicht nur Männer mobilisiert, sondern auch Frauen, die noch minderjährige Kinder bei sich hatten. Maria Iwanowna Adolf wurde nur deswegen nicht eingezogen, weil sie kurz nach der Ausweisung aus dem Wolgagebiet schwer erkrankte. Und zwar so schwer, dass sie nicht mehr in der Lage war, sich um ihre Kinder zu kümmern. Darüber berichtete ihre Tochter, die Einwohnerin von Karatus – Emilie Augustowna Gatilowa (Adolf).
Im Oktober 1941 brachte man sie in das Dorf Aleksandrowaka im Karatussker Bezirk. In ihrer Familie gab es acht Kinder. Sie kamen in irgendeiner Baracke unter, wo es von Wanzen nur so wimmelte. Aus der Heimat hatten sie fast nichts mit hierher nehmen können, Schlafen mussten sie auf Stroh. Zusätzlich zu den Wanzen wurden alle noch von Läusen befallen. Für die reinlichen Deutschen stellte das eine einzige Tragödie dar. Emilies Mutter erkrankte bald darauf. Die erlittenen seelischen Erschütterungen aufgrund der gewaltsamen Umsiedlung machten sich bemerkbar.
Im Winter 1942 holten sie Emilie Augustownas Vater, ihren ältesten, 17 Jahre alten Bruder Sascha, die 15-jährige Schwester Irma und ihren leiblichen Onkel Philipp in die Trudarmee. Dem Vater gelang es wie durch ein Wunder Arbeit in der Küche zu finden; dadurch konnte er überleben, aber sein Bruder verstarb dort.
In Aleksandrowka blieben sechs kleine Kinder ohne Ernährer zurück, sie hungerten und litten große Not. Die sechsjährige Emilie und ihr vierjähriger Bruder Edik zogen durch die umliegenden Dörfer und bettelten um Almosen: «Wir hatten eine kleine Tasche über die Schulter gehängt, und sie gaben uns etwas. Du klopfst an die Pforte – manchmal bekommst du etwas und manchmal lassen sie dich noch nicht einmal den Hof betreten. Nicht weit entfernt, in Kurjaty, lebten viele Ukrainer. Das waren gute Menschen. Ohne sie hätten wir das erste Jahr nicht überlebt. Sie schenkten uns nicht nur Almosen, sondern brachten auch etwas für die kranke Mama in die Baracke. Es war allerdings nicht viel, nur so viel, wie sie abgeben konnten. Schließlich hatte jeder von ihnen seine eigene Familie».
Besonders an einen Vorfall erinnert sich Emilie Alexandrowna. In einem der Häuser in Kurjaty schenkte man ihr eine Maultasche. Sie wusste nicht, was das ist, hatte es zuvor nie gesehen und probiert. Hinter der Pforte öffnete sie die Handfläche, um das herrlich duftende, warme Mehlteilchen zu betrachten, aber in dem Augenblick schlich sich ein Hund heran und entriss ihr den Almosen. Den innerlichen Schmerz empfindet sie bis heute. Aus ihrer Kindheit erinnert sie im Großen und Ganzen nur den Hunger, der Tag und Nacht auf Schritt und Tritt ihr Begleiter war.
Nach dem Krieg wurde es nicht einfacher. Man verlegte sie nach Chaibalyk. Der zurückgekehrte Vater arbeitete entsprechend seiner Berufsausbildung; in der Heimat, an der Wolga, hatten ihn deswegen die Dorfbewohner sehr geschätzt, ‒ er war Tierarzt. Doch hier fand sich schnell ein Anlass, um ihn der Schädlingstätigkeit zu beschuldigen und ins Gefängnis zu bringen.
Der Mutter ging es immer schlechter, und bald darauf starb sie. Bruder Sascha kehrte psychisch krank aus der Arbeitsarmee zurück. Später erlitt er einen Hirnschlag. Man brachte ihn ins Minussinsker Krankenhaus. Von dort brachte Schwester Irma ihn mit gemieteten Ochsen nach Hause. Sie holte ihn zum Sterben heim.
Viele Jahrzehnte leben wir in Sibirien zusammen mit Russland-Deutschen, und wissen fast nichts über das Unheil, das auf ihr Los entfiel. Sie haben sich nie irgendjemandem mitgeteilt. Sie schwiegen selbst und befahlen ihren Kindern zu schweigen. Die Archive wurden geschlossen. Die Münder der Masseninformationsmittel - ebenfalls. Und erst mit Beginn der Perestroika öffneten sich die Schleusen. In den Zeitungen erschienen persönliche Geschichten von Repressionsopfern. Dieses einst verbotene Thema wählen schulisch-heimatliche Vereinigung zum Studium aus. Studenten schreiben darüber Diplomarbeiten, wissenschaftliche Mitarbeiter verteidigen ihre Dissertation. Im Sommer 2016 und 2017 arbeitete im Karatussker Bezirk eine Expedition der Pädagogischen Universität Krasnojarsk mit der Gesellschaft «Memorial». 36 persönliche Geschichten hörten sie hier. Und in jeder von ihnen liegt eine Tragödie. Aber etwas Gemeinsames wohnt ihnen inne: die stalinistische Deportation vom 28. August 1941 teilte ihr Leben in ein «DAVOR» und «DANACH».
Verwendet wurden Materialien der Mitglieder der wissenschaftlichen Expedition im Karatussker Bezirk Aleksej BABIJ, Jelena SBEROWSKAJA, Darja SBIRINA, Tatjana HASAREZ und Marina KONSTANTINOWA.
Ein großes Dankeschön an die Befragten, die ihr Einverständnis zur Veröffentlichung ihrer persönlichen Geschichte gaben. Wir wünschen ihnen Gesundheit und die Liebe und Fürsorge ihrer Angehörigen.
Zum Druck vorbereitet von Tatjana KONSTANTINOWA.
29.10.2020