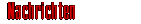

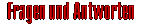



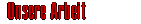




Auf einem Treffen am 30.Oktober letzten Jahres, das dem Gedenken an die Opfer der politischen Repressionen gewidmet war, teilte Nadjeschda Schumkowa, Einwohnerin von Jermakowo, ihre traurige Familiengeschichte mit; sie wurde am Verbannungsort ihrer aus dem Wolgagebiet deportierten Mutter – Maria Alexandrowna Beis – geboren. Mit 18 Jahren geriet das deutsche Mädchen in die nordsibirische Siedlung Dorofejewsk im Ust- Jenisseisker Bezirk. Dorthin hatte man Verbannte unterschiedlicher Nationalitäten gebracht: Deutsche, Finnen, Balten, Kalmücken, Russen. Männer gab es praktisch nicht – sie waren in die Arbeitsarmee, zu Betrieben der Region oder zum Holzeinschlag, mobilisiert worden. Deswegen formierten sich die Fischerei-Genossenschaften in den Stanoks (so nannte man die kleinen Siedlungen im Hohen Norden) aus Frauen und Kindern. Die Menschen wurden durch Kälte, Hunger, der alle Kräfte übersteigenden Schwerstarbeit und Krankheiten nur so dahingerafft...
Schon bei der Begegnung erzählte Nadjeschda Pawlowna Einzelheiten vom Überlebenskampf der Deportierten, worüber ihr die Mutter seinerzeit berichtet hatte und was sie später im Buch „Kerze der Erinnerung“ nachlesen konnte, welches vom Taimyrsker Heimatkunde-Museum herausgebracht wurde.
Ihre Mutter, Maria Beis, wurde 1923 in Marxstadt, Gebiet Saratow, in eine deutsche Bauernfamilie hineingeboren. Der Vater starb einen Monat vor Ausbruch des Krieges, im Mai 1941. Und am 16. September, nachdem sie ihren Ernährer verloren hatte, wurde sie bereits in den Tajewsker Bezirk, Region Krasnojarsk, ausgesiedelt.
Man verschickte die Menschen in aller Eile. «Meine Tante hatte einen Teig stehen, sie wollte Brot backen, aber man erlaubte ihr nicht, es für unterwegs fertig zu backen», - erinnerte sich Maria später. Bis nach Saratow fuhren sie auf einem Lastkahn, anschließend waren sie einen ganzen Monat lang mit dem Zug unterwegs. Sie fuhren einen Umweg über Kasachstan. Mitte Oktober trafen sie im Dorf Bjessolaja im Tajewsker Bezirk ein. Dort arbeitete Maria in der Kolchose als ungelernte Arbeiterin – sie war Melkerin, mähte Heu. Anfang Juni 1942 berief man das Mädchen ins Kriegskommissariat.
- Ich war Komsomolzin, - erzählte Maria. – Ich dachte, dass ich vielleicht Verwundete verbinden könnte, schließlich verfügte ich über eine medizinische Ausbildung. An unserer deutschen Schule hatte es so einen Unterricht gegeben, in dem wir lernten, wie man erste Hilfe leistet. Aber es stellte sich heraus, dass wir in den Hohen Norden fahren sollten, dort benötigte man Arbeitskräfte. Wir durften uns von den Angehörigen nicht verabschieden. Sie hatten Angst, dass wir uns verstecken oder fliehen könnten. Aber wo sollten wir uns denn da verstecken, wir konnten doch noch nicht einmal Russisch. Man erklärte uns, dass wir für drei Monate fortmüssten und dann wieder nach Hause geschickt würden. Und seitdem habe ich die Mama nicht mehr gesehen. Sie blieb in Sibirien.
Die Fahrt der Verbannten führte in den Ust-Jenisseisker Bezirk, Autonomes Gebiet Taimyr. Sie fuhren auf einem Leichter, den das Bugsierschiff «Molotow» ins Schlepptau genommen hatte, über den Jenissei. Sie brachten uns zur Siedlung Dorofejewsk, die sich 400 Kilometer nördlich von der Siedlung Ust-Port befindet. Am Ufer wurden wir abgesetzt. Und dort lag noch Schnee. Wir schliefen unter umgekehrten Booten. In der Siedlung gab es nur wenige Häuser, in den Russen wohnten, ebenfalls Verschleppte, die früher enteignet worden waren. Sie betrieben Fischfang. Zu dieser Arbeit wurden auch die Neuankömmlinge herangezogen.
An der Wolga hatte Maria auch mit ihrem Vater fischen müssen. Aber dort hatten sie die Fische mit Netzen gefangen, während man hier Schleppnetze benutzte. Normale Netze sind leicht. Ein Schleppnetz ist schwer und hat eine Länge von 350-400 Metern. Mehrmals musste es im Jenissei ausgeworfen werden. Es war furchtbar schwer zu ziehen – man kann es nicht beschreiben. Es gab keine Stiefel, kein anderes geeignetes Schuhwerk. Bei Regen arbeiteten sie barfuß.
Der Nordsommer ist kurz, bisweilen fällt im Polargebiet bereits im September Schnee. Aber sie, die Sondersiedler, mussten sich im Spätherbst mit dem Fischfang beschäftigen, wobei sie mit nackten Füßen im eisigen Wasser standen. Aber was sollt man machen – der Fang-Plan musste ja erfüllt werden! Diejenigen, die mit der Norm nicht zurechtkamen, bekamen eine reduzierte Essensration. Und sie bestand insgesamt aus 200 Gramm Brot am Tag. Es schien, dass der Jenissei voller Fische war. Iss nur – ich will nicht. Aber so war es nicht: den Verschleppten war es nicht gestattet, sich von dem gefangenen Fisch etwas für den Eigenbedarf zu nehmen.
Deswegen waren sie nicht nur schlecht mit Kleidung und Schuhwerk ausgestattet, sondern sie hungerten auch. Einer tauschte seine Sachen (sofern er welche besaß) gegen Lebensmittel ein. Einem anderen half die Ortsbevölkerung zu überleben, die mit den Umsiedlern alles teilte, was sie nur abgeben konnte. Die Frauen aus dem Baltikum, beispielsweise, trafen in seidenen Sommerkleidern in der Siedlung ein (denn man hatte ihnen gesagt, dass sie nur für zwei Monate fort sein würden). Und wenn es in der Siedlung keine mitfühlenden Einwohner gegeben, hätten sie wohl kaum den harten Nordwinter überlebt.
Etwas später schickten sie Maria zur Fischannahmestelle in die Siedlung Karepowsk, wo ausschließlich Nenzen tätig waren. Sie war unter ihnen völlig allein. Sie erinnerte sich: «Die Nenzen beleidigten die Verbannten nicht. Sie waren sehr liebe Menschen. Es gab keine großen Raufereien unter ihnen. In ihrer Kolchose gab es einen guten Vorsitzenden – Iwan Fjodorowitsch Samarskij. Er sorgte dafür, dass sie nicht so viel Alkohol tranken. Die Nenzen achteten ihn und sagten: «Er hat uns zu Menschen gemacht!».
Bis 1958 befand Maria Beis sich in Dorofejewsk, anschließend ging sie nach Ust-Port. Zu der Zeit besaß sie bereits eine Familie, vier Kinder. Es war eine schöne, saubere Siedlung. Es gab dort einen großen Klub. Die Menschen lebten einträchtig miteinander. Am neuen Wohnort fand Maria Arbeit in der Fischkonserven-Fabrik. Die Arbeit begann um acht Uhr morgens (zehn Minuten vor Arbeitsantritt ertönte bereits die Sirene). Nach und nach kam das Leben wieder zurecht...
Für Nadjas Tochter wurde Ust-Port zur kleinen Heimat, in der sie ihre Kindheit und ihre Schuljahre verbrachte. Sie trug den Nachnamen der Mutter – Beis. Aber in der Abschlussklasse riet der Stiefvater ihr, seinen russischen Familiennamen anzunehmen. Er hatte Angst, dass man ihr als Deutschen in der weiteren Zukunft Schaden zufügen könnte. So schrieb sich Nadjeschda am Krasnojarsker Institut für Pädagogik bereits mit dem Familiennamen Smirnowa ein.
Nadjeschda Pawlowna sagt, dass ihre Mutter nur sehr spärlich über ihre Deportation und die ersten und schwierigsten Jahre im Norden erzählt hätte. Zu groß war die Angst etwas Überflüssiges zu sagen und dafür bitter bezahlen zu müssen. Es war noch nicht einmal die Angst um sich selbst, sondern um die ihrer Kinder.
Viel mehr erfuhr sie aus dem Buch «Kerze der Erinnerung», welches man ihr im Dudinsker Heimatkunde-Museum schenkte. Darin fand sie auch die Erinnerungen ihrer Mutter und deren Freundin Luise Filbert sowie zahlreicher anderer Sonderumsiedler, die in den ersten Kriegsjahren an den Ufern verschiedener Siedlungen des Jenisseisker Nordens ausgesetzt wurden, deren Schicksal jedoch sehr ähnlich verlief.
Luise Davidowna Filbert lernte Maria Beis bereits in Ust-Port kennen, beide arbeiteten in der Fischfabrik und lebten als Nachbarinnen in einem zweistöckigen Haus. Es stellte sich heraus, dass Iwan, Marias Bruder, gemeinsam mit ihr am Marxstädter Institut für Pädagogik studiert hatte. Seitdem waren die beiden Frauen unzertrennliche Freundinnen.
Aus Luise Filberts Erinnerungen
«Der 19. Juni 1941 fand in unserer pädagogischen Fachschule der Entlassungsabend statt, und drei Tage später brach der Krieg aus, der unser ganzes Leben durcheinanderbrachte. Am Morgen des 31. August traf ich mich mit meinen zukünftigen Schülern, und nach dem Mittagessen erfuhr ich, dass die Deutschen umgesiedelt würden. An diesem Tag wurde die Schule von Soldaten besetzt. In der Nacht fuhr ich ins Dorf zu den Verwandten. Aller waren voller Leid und weinten. Am 4. September verließ die ganze Familie – ich, Mama und mein Bruder – für immer unser Zuhause…
Im Juni 1942 schickten sie uns mit der ersten Partie Sondersiedler auf dem Jenissei in den Norden. Am 1. Juli setzten sie uns, mitten im Ufersand, auf den Nossonowsker Inseln, unweit der Siedlung Ust-Port, ab. Die Menschen lagen entlang des Ufers des Jenisseis. Ein Sturm kam auf, alle wurden vom Sand bedeckt. Es stellte sich heraus, dass es in der Siedlung lediglich einen kleinen Laden und eine Fischannahmestelle gab. Häuser waren nirgends zu sehen. Wir beschlossen, eine Behausung aus Grassoden zu bauen. Es waren hauptsächlich Frauen und halbwüchsige Kinder daran beteiligt, denn die gesunden Männer hatten sie in die Arbeitsarmee geholt. Von Juli bis Mitte Oktober hausten wir in Laubhütten. Zu der Zeit organisierte man die Kolchose «Fischer des Nordens». Wir begannen mit dem Fischfang. Ständig wiederholte man uns: «Euer Essen findet ihr im Jenissei». Bis in den tiefsten Herbst fischten wir barfuß im Schnee.
Der erste Mensch starb bei uns am 12. November. Begraben wurde er in Ladyginskij Jar. Einen jungen Mann fraßen bei lebendigem Leib die Läuse. Im Dezember brach Skorbut aus. Bei den Leuten entzündeten sich das Zahnfleisch und die Gelenke. Sie lagen massenhaft danieder. Diejenigen, die noch laufen konnten, halfen den Kranken so gut sie es vermochten. Lebensmittel wurden nur bis Januar ausgegeben. Um sich vor dem sicheren Hungertod zu bewahren, kochten und aßen die Menschen Lemminge.
Im ersten Winter starben zwanzig Leute durch Hunger und Skorbut. Es war der schwierigste Winter. Im März brachte man uns Rentierblut und Fichtennadel-Sud. Alle wurden gezwungen, diese bittere Brühe zu trinken. Schwer erkrankten auch meine Mama und mein Bruder, ich blieb merkwürdigerweise auf den Beinen. Mama rette meinen Bruder und mich vor dem Hungertod. Aus Wolle, die sie von der Wolga hatte mitbringen können, strickte sie warme Sachen und tauschte sie gegen Lebensmittel ein.
Was wir nicht alles machen mussten! Wir beschafften auf dem Jenissei Eis, transportierten Torf und Kohle. Es war schwer, aber wir lebten in der Hoffnung, dass nach dem Krieg alles in Ordnung kommen und man uns nach Hause zurückkehren lassen würde. Wir dachten: «Wie wird es wohl an der Wolga ohne uns sein?»
In der Siedlung Ust-Port lebten Vertreter von insgesamt dreizehn Nationalitäten. Sie lebten einträchtig miteinander...
1948 mussten wir Deutschen ein Stück Papier unterschreiben, dass wir nie mehr in unsere Heimat zurückkehren, sondern für immer hierbleiben würden. 1956 fuhren viele Sondersiedler fort in ihre heimatlichen Gefilde, aber vor allem die Deutschen blieben zurück. Es gab nichts, wohin sie hätten fahren können. Ich und meine alte Mutter – Therese Andrejewna Karle – träumen oft von unserem Heimatdorf, unserem Haus, der Wolga… Ich wäre wieder an die Wolga zurückgegangen, wenn nur das Haus noch da gewesen wäre…»
Übrigens, Theres Andrejewna Karle starb 1995 in der Siedlung Ust-Port. Im Museum steht das Spinnrad, das sie wie durch ein Wunder von der Wolga mitgenommen hatte und welches für die Familie während der Verbannung am Polarkreis sehr hilfreich war.
Grundlage für die Deportation der Völker unseres Landes war das Misstrauen ihnen gegenüber. So wurden die Wolgadeutschen bei Kriegsausbruch von heute auf morgen zu Saboteuren und Spionen erklärt. Dazu heißt es im Dekret des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR vom 28. August 1941: «… gibt es innerhalb der in den Wolgagebieten lebenden deutschen Bevölkerung tausende und abertausende Diversanten und Spione, die, auf ein entsprechendes Signal aus Deutschland hin, in den von Wolgadeutschen besiedelten Regionen Sprengstoffanschläge verüben sollen...» Wir merken dazu an, dass bis heute weder ein zuverlässiger Tatbestand noch irgendein Dokument gefunden wurde, welche das Vorhandensein einer Vereinbarung zwischen den Wolgadeutschen und dem Dritten Reich bestätigen könnten.
In demselben Dekret heißt es, dass die umzusiedelnden Deutschen Grund und Boden zugeteilt bekommen und staatliche Unterstützung bei der Einrichtung in den neuen Bezirken erhalten würden. Wenn wir allerdings die Erinnerungen im Buch «Kerze der Erinnerung» lesen, können wir uns davon überzeugen, dass die im Norden ausgesetzten Deutschen, ebenso wie andere Verbannte, die am neuen Wohnort keine einzige Behausung vorfanden, diese aus behelfsmäßigen Materialien selbst errichteten, sich aber vorwiegend Erd-Höhlen gruben. Und das unter den Bedingungen des ewigen Frostes, wo der Boden im Sommer bestenfalls bis zu einem Meter Tiefe auftaut. Es ist schon gruselig zu lesen, dass einer der Umsiedler auf dem Friedhof der Siedlung ein leeres Grab entdeckte und sich darin niederließ. So sahen also die staatliche Hilfe und die Zuteilung von Grund und Boden aus!
Im Februar dieses Jahres beschloss Nadjeschda Pawlowna eine Zeit lang an den Orten ihrer Kindheit zu verbringen, um dort das Gedenken an ihre Mutter und ihre Landsleute zu würdigen. In Ust-Port konnte sie aus objektiven Gründen nicht verweilen, aber von ihrem Bruder Boris, der bis vor kurzem dort lebte, erfuhr sie von den Veränderungen in der Siedlung. Sie besuchten das Heimatkunde-Museum in Dudinka, schauten sich Ausstellungsstücke an, die den Opfern der politischen Repressionen gewidmet waren, standen vor dem zu ihren Ehren aufgestellten Gedenkstein, besuchten Gedenkstätten in der Stadt. Eine von ihnen ist eine hölzerne Brücke, über die die Häftlinge vor ihrer Verschickung ins NorilLag, zum Bau der Bahnstrecke Igarka – Salechard und dem Dudinsker Seehafen, geführt wurden.
Niemand und nichts ist vergessen...
Larissa Golub,
Vorsitzende der Jermakowsker Filiale der
Vereinigung der Rehabilitierten der Region Krasnojarsk
Auf den Fotos: Frachttransport auf einem der Schlitten (hinten Maria Beis); Maria Beis (Mitte) in Ust-Port; Nadjeschda Schumkowa mit Bruder Boris auf der Dudinsker Gedenkbrücke. Fotos aus Schumkowas persönlichem Archiv
.


„Niwa“ (Jarmakowskaja), 22.10.2020