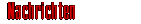

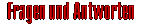



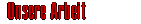




Der Sommer 1972 war sehr heiß, und es gab gewaltige Brände in den Schatursker Sümpfen, so daß der gesamte Moskauer Raum in Qualmwolken verhüllt war. Viktoria und ich beschlossen, dem Rauch auf dem Wasserwege in Richtung Norden zu entfliehen und auf dem Mariinsker Kanalsystem Peters I bis zum Weißen Meer, bis zu den Solowetzki-Inseln, zu fahren. Nachdem wir uns in einem Laden für geographische Werke an der Kusnetschnij Most (Schmiede-Brücke; Anm. d. Übers.) mit den entsprechenden Karten jener Gegend und einem Fahrplan für die Transportmittel zu Wasser ausgestattet hatten, legten wir die Route von Moskau bis Solowki ausschließlich auf dem Wasserwege fest; den Rückreiseweg von Astrachan nach Moskau wollten wir dann mit dem Flugzeug zurücklegen. Die gesamte Planung unserer Reise, angefangen mit dem 20. August, fand innerhalb von zehn Tagen statt, wobei wir auch ganz exakt die Kosten für Transport und Verpflegung berechneten. Damit es keine Schwierigkeiten mit den Übernachtungen gab, nahmen wir zwei Luftmatratzen mit, denn an den Anlegestellen würde sich stets irgendein Platz für zwei Personen zum Schlafen finden. Die Reise begann am Chimkinsker Flußbahnhof in Moskau.mit dem Raddampfer „Pomjalowskij“. Witja begleitete uns. Unsere Dampferfahrt führte uns über Jaroslavl, und es dauerte fast vierunzwanzig Stunden, bis er dorthin geplätschert war. Wir fühlten uns wohl, weil in der Kajüte keinerlei Vibrationen zu spüren waren, denn das Schiff verfügte über eine Dampfmaschine; alles war still, und wir ergötzten uns am Anblick der Ufer, indem wir durchs Fernrohr sahen, und auch die Kinder der anderen Passagiere baten uns häufig einmal hindurchschauen zu dürfen. Da wir fürchteten in Kotlas keine Fahrkarten bekommen zu können, gaben wir im Namen des Verantwortlichen der Anlegestelle ein Telegramm mit folgendem Wortlaut auf: „Bitte um Reservierung einer 2-Personen-Kajüte bis nach Archangelsk. Petri“. Wir unternahmen eine Exkursion zum Kyrillo-Beloserskij-Kloster, sahen das zerstörte, jahrhundertealte Grab seines Gründers, des Heiligen Kyrill, von dem die Bolschewiken auf Anweisung Lenins in den zwanziger Jahren die Grabplatte aus reinem Silber entfernten. Heute liegt hier an ihrer Stelle eine ganz gewöhnliche Betonplatte. Großes Interesse weckte in uns das berühmte historische Mariinsker Wassersystem, welcher das Wolgabecken mit der nördlichen Dwina verbindet und ins Weiße Meer führt. Wir schwammen auf dem Fluß Suchona an den Städten Kyrill und Wologda vorüber bis nach Kotlas. Wir stiegen auf den Glockenturm der Wologder Kirche hinauf und sahen die elf Glocken, die noch vor Zar Peters Zeiten gegossen worden waren: russische, holländische, deutsche. Wir wollten wissen, weshlab Peter I sie nicht für Kriegszwecke abgegeben hatte. In der Tat hätte der Dekan der Kirche aufgrund eines Ukas, den Peter erlassen hatte, für sein Vergehen auch gehängt werden müssen. Aber als der Zar eines Tages auf der Durchreise durch Wologda war, bat der Dekan ihn, dem Spiel der Glocken zu lauschen, welche die Melodieder Volksweise „Kamarinskaja“ ertönen ließen. Peter dachte einen Augenblick nach und meinte dann: „So soll es sein!“ – und mit diesen Worten verzieh er der Stadet Wologda, weil ihre Glocken so schön geklungen hatten, so daß den Meistern ihres Fachs ihr Glocken-Musikinstrument erhalten blieb. Bis heute sind noch die uralten Schleusen in Betrieb, mit denen der Wasserstand um 2 m abgesenkt werden kann. Wir waren auch sehr erstaunt, daß die Schleusenwände, dicht an dicht, mit Lärchenhölzern befestigt waren. Die Reisebegleiter betonten, daß diese Stämme, die im Wasser nicht faulen, auf Befehl Peters I aus Sibirien herbeigeschafft worden waren. Während unserer Reise war uns immer warmes Wetter beschert. In Kotlas erwartete uns eine riesige Schlange Menschen, die alle nach Fahrkarten anstanden, die ganze Anlegestelle war voller Leute, aber wir, mit unseren Rucksäcken auf den Schultern, wagten es, schnurstracks zum Leiter der Anlegestelle zu gehen. Er begrüßte uns freundlich und teilte uns mit, daß er unser Telegramm erhalten und für uns eine Zwei-Mann-Kajüte reserviert habe; die Billets könnten wir am Vorbestell-Schalter bekommen. Ohne Warteschlange erwarben wir unsere Karten und begaben uns sogleich an Bord des Schiffes, das aufgrund des niedrigen Wasserstands und der zahlreichen Sandbänke noch eine Weile abwarten mußte, bis das Wasser ein wenig gestiegen war. Auf dem Fluß lagen mit Holz beladene Flöße, die zum Archangelsker Holzkombinat abgeflößt werden mußten. Unser Schiff, das wohl Passagiere, aber keine Frachten mitnahm, setzte sich gegen Abend außerfahrplanmäßig in Bewegung und fuhr langsam die Nördliche Dwina flußabwärts. In dieser nördlichen Gegend Rußlands fiel uns ganz besonders die dörfliche Architektur der Häuser auf: das Haus mit „Hof“ für das Vieh, und alles unter einem gemeinsamen Dach, wohin die Leute im Winter mit Pferdeschlitten das Heu bringen, um dann das Vieh damit zu füttern, indem sie das Heu einfach nur abwerfen. Dieses Verfahren erleichtert die winterliche Pflege und Sorge um das Vieh in erheblichem Maße. In Archangelsk übernachteten wir auf dem Seebahnhof, wo uns gegen Mitternacht ein Milizionär weckte und unsere Papiere sehen wollte. Ich zeigte ihm unsere Pässe, dabei lächelte er, blickte auf unsere Luftmatratzen und meinte: „Schlafen Sie weiter!“ – Am Morgen erfuhren wir, daß es in nächster Zeit keine Transportmöglichkeit zu den Solowki-Inseln geben würde, weder mit einem Passagierschiff auf dem Wasserwege, noch per Flugzeug. Aber man munkelte uns zu, daß sich am Abend, um 18 Uhr, von der Anlegestelle aus ein Seeschiff auf eine Expeditionsfahrt zu den Solowker Inseln begeben würde; das Schiff hieß „Tatarija“, und seine Passagiere würden mit Reisescheinen von Unternehmen auf Fahrt gehen. Ich sagte Viktor, daß wir gerettet wären, denn wir befanden uns schließlich in Rußland, und da würden sie uns ganz sicher mitnehmen, selbst wenn wir nur in der 4. Klasse an Deck untergebracht wären. Es war bereits 17 Uihr abends, als wir uns an der herrlichen Seeanlegestelle mit seinen Denkmälern Peters des Ersten und verschiedener Polarforscher, Teilnehmern an Polarexpeditionen im Eismeer, einfanden. Dort steht auch ein Denkmal des bekannten Polarforschers und ersten Leiters der Hauptverwaltung des Nordmeer-Seeweges O.J. Schmidt. Unsere „Tatarija“ hatte bereits an der Pier festgemacht, die Gangway war herabgelassen und am Eingang stand der diensthabende Matrose. Auf unsere Frage gab er uns zur Antwort, daß wir uns an den für die Passagiere zuständigen Assistenten des Kapitäns wenden sollten, der oben an Deck stand. Ich stieg zu ihr hinauf, und sie schlug uns vor, das Ende der offiziellen Einschiffung abzuwarten, dann würde man weitersehen. Langsam bewegte sich die Schlange der Exkursionsteilnehmer vorwärts. Ein Mann mit Angelruten tauchte auf, der ein wenig abseits von allen stehenblieb. Ich stieß Viktor mit dem Ellenbogen an, zeigte dabei auf den Fischer – er besaß auch keine Fahrkarte und war überzeugt, daß man ihn trotzdem mitnehmen würde, und dann nähmen sie uns ganz bestimmt auch auf. Die Schiffssirene tönte zum ersten Mal. Und da kommt plötzlich ein junger Mann, bekleidet mit einem Schutzanzug der Studenten-Baubrigade, über den ganzen Platz gerannt, rudert mit beiden Armen, rennt auf die beim Fallreep stehende Kapitänsgehilfin zu und bittet darum, die Abfahrt des Schiffes um eine Stunde zu verschieben, denn die Studenten hatten für die gute Arbeit, die sie geleistet hatten, vom Zentralkomitee der Allrussischen Leninistiscch-Kommunistischen Jugendorganisation Reisegutscheine erhalten, aber aufgrund der zahlreichen Sandbänke im Fluß wird ihr Motorschiff erst mit einstündiger Verspätung in der Stadt eintreffen. Die Kapitänsassistentin lehnte die Bitte des Bautruppleiters kategorisch ab. Erneut stieß ich Viktor mit dem Ellbogen an und meinte: uns werden gleich nicht nur zwei Fahrkarten, sondern auch gleich noch 75 weitere angeboten – und dazu noch ganz umsonst. Und so kam es auch. Aber mein Gewissen ließ es nicht zu, den Mißerfolg der Studenten einfach auszunutzen, und so zog ich meine letzten 21 Rubel hervor (das Rückflugticket hatte ich ja schon gekauft) und stopfte sie dem Kommandierenden der Studententruppe vom Moskauer Bauinstitut (MISI) mit Mühe in die Brusttasche; er gab mir zwei Reisegutscheine für das Schiff (dabei kostete eine Fahrt allein schon 45 Rubel). Als die Schiffssirene zum dritten Mal ertönte, gingen Viktoria und ich als legale Passagiere über die Gangway an Bord. Wir eilten an Deck und begaben uns erst in unsere Kajüte, als alle sich an Bord der „Tatarija“ befanden. Wir hatten eine Viererkabine mit einem runden Bullauge. Während wir uns einrichteten, wurde über das Radio eine Einladung zum Abendessen bekannt gegeben. Wie groß war unsere Verwunderung, als wir im Bugrestaurant mit herrlichem Essen komplett gedeckte Tische für 75 Personen sahen, und wir beide allein sollten an einem von ihnen Platz nehmen. Musik spielte, aber es wurde nicht getanzt, und man hörte auch kein jugendliches Gelächter, denn es fehlten jene, die es aufgrund iher guten Arbeit verdient gehabt hätten, die Freude an der Reise und einer solchen Bewirtung zu genießen. Wir schwammen an einem riesigen Holzkombinat mit unendlich vielen Baumstämmen vorüber, an Holzfracht-Terminals, an denen ausländische Schiffe mit Holz beladen wurden. In der Nacht kam ein Sturm auf, und wir mußten das Bullauge schließen. Gegen Mittag des folgenden Tages erreichten wir die Solowetzker Inseln, das mit seinem „SLON“ (Abkürzung für „Solowetzker Lager mit besonderer Bestimmung“; Anm. der Übers.). Unsere aus zehn Personen bestehende kleine Touristengruppe wurde vor dem Abmarsch zur Insel mit einem guten Frühstück versorgt; anschließend wurde dann die Exkursion zufuß organisiert, beginnend mit Berichten über die viele Jahrhunderte zurückliegende Geschichte der Insel, bis hin zum Besuch der am meisten interessierenden Orte. Hierher kamen russische Menschen aus dem ganzen Lande, um für ihre Sünden zu beten, während sie als Mönche einzig und allein für ihr Essen arbeiteten. Unser Reiseleiter hatte die Geschichte der Solowsker Inseln studiert und über das gesammelte Material seine Dissertation geschrieben. Das wichtigste Objekt der Solowsker Insel ist die Kathedrale, die zu Sowjetzeiten in ein Gefängnis umgewandelt wurde. Während der Herrschaft Kathatrinas II saß in dem 1,5 m hohen Keller der Kathedrale, in einer unbeheizten, 3 x 2 m großen Zelle, 25 Jahre lang ein ukrainischer Ataman; im Alter von 105 Jahren wurde er freigelassen. Man stieß ihn hinaus in die Freiheit, wo er durch das grelle Tageslicht sofort erblindete. Seine marmorne Grabplatte ist erhalten geblieben, aber wo sich tatsächlich sein Grab befindet ist nicht bekannt. Auf der Platte steht die gtanze Geschichte des Atamans geschrieben. Auf der Insel gibt es auch noch eine „Verhandlungs“-Platte – an der Stelle, wo im Jahre 1918 die Verhandlungen zwischen dem Admiral der englischen Kriegsschwadron und dem ortsansässigen Erzbischof anläßlich der Versorgung der Schiffe mit Süßwasser stattgefunden hatten. Das Ersuchen der Engländer wurde abgelehnt, da sie zu den Feinden des neuen revolutionären Rußlands zählten. Es begann ein heftiger Beschuß aus den Kanonen der Schiffsartillerie. Aber die Klosterfestung aus riesigen, tonnenschweren Findlingen hielt stand. Die Stellen, an denen die Wände des Klosters und der eigentlichen Festung getroffen wurden, wurden mit schwarzen Kreisen kenntlich gemacht. Die Kathedrale war stets von einem goldenen Kreuz auf der Kuppel gekrönt. Vom Augenblick der Schaffung des „SLON“ Ende der 1920er Jahre an wurde die Kuppel anstelle des Kreuzes mit einem roten Stern versehen, der dort bis heute erhalten ist. Heute besteht das Unglück der Solowker Insel darin, daß es hier nach dem Solowezker Lager keinen Hausherrn mehr gibt. Vielleicht wird ja jetzt das Kircheneigentum wiederhergestellt? Die Exkursion endete am Abend, und wir kehrten todmüde, aber sehr zufrieden mit all dem, was wir gehört und gesehen hatten, zum Abendessen auf unser Schiff zurück. Zum Archangelsker Flughafen gelangten wir aufgrund unserer Flugtickets kostenlos mit einem Bus der Flugagentur, und in den Automaten der Moskauer Metro warfen wir schließlich unsere letzten beiden Fünf-Kopeken-Stücke ein. Ich denke, daß eine derart exakte Einhaltung des Zeitplans unserer Tour, aber auch die peinlich genaue Berechnung der dafür nötigen Ausgaben, in heutiger Zeit nicht mehr möglich ist. Am 30. August kehrten wir nach Hause zurück, und am 31. fand ich mich bereits in der Aula zur allgemeinen Hochschullehrer-Versammlung des Moskauer Instituts für Energetik ein. Die Expedition, an der wir teilgenommen hatte, barg nicht nur einen hohen Erkenntniswert in sich, sondern verfügte auch über einen erzieherisch wertvollen sowie patriotischen Charakter. Für Viktor hatte es innerhalb der zehn Tage viele Gelegenheiten gegeben, das Leben so zu sehen, wie es ist, und wie man Engpäße überwindet. Nachdem wir von den Solowsker Inseln zurückgekehrt waren, begann Viktor am Staatlichen, wissenschaftlichen Forschungsinstitut für Energiewissenschaften zu arbeiten und befaßte sich dort mit der planmäßigen Thematik des Ministeriums für Energie. Es kam die Zeit, als Viktor an einem der Abende im Forschunsinstitut Natascha kennenlernte (seine zukünftige Ehefrau), die in einem anderen Laboratorium tätig war und die Abendschule des Eisenbahn-Instituts besuchte. Später, nach einer fröhlichen Hochzeitsfeier in einem der Restaurants auf der Ausstellung der Errungenschaften der Volkswirtschaft, zog Natascha zu uns nach Nowogirejewo um. 1973 wurde Witjja entsprechend dem Verteilungsschlüssel seines Konzerns „SonderElektroMontagen“ das Recht zugestanden, sich ein Auto der Marke „Schiguli“ anzuschaffen, welches Witja und ich für 7200 Rubel (es war das dritte Modell) am Fahrzeuglager in Noginsk kauften. Auf den Vorschlag von Onkel Mischa hin waren wir bereits ein Jahr zuvor der Garagenkooperative mit insgesamt 1000 Plätzen beigetreten. Als Vorsitzender wurde das Vorstandsmitglied der Garagen-Genossenschaft, ein Held der Sowjetunion und General-Major, gewählt. Die Kosten für eine Park-Box betrugen 1500 Rubel. So lange die Bautätigkeiten noch nicht abgeschlossen waren, erteilte Onkel Mischa uns eine Vollmacht für seinen „Pobeda“, denn Mitglied der Kooperative konnte nur derjenige werden, der auch ein Fahrzeug besaß. Der Bau des fünfgeschossigen Gebäudes wurde innerhalb von fünf Jahren vollendet. Im Kellergeschoß wurde eine Filiale der Toljattinsker Autofabrik mit mehreren Werkstätten für den Reparaturbertieb sowie die Versorgung der Kooperative mit Ersatzteilen eingerichtet. Es war äußerst angenehm und bequem für die Fahrzeughalter hier in qualifizierter Weise bedient zu werden. Als der Garagenbau abgeschlossen war, kam der glückliche Augenblick der Verlosung der Park-Boxen. Wir beauftrageten Natascha damit, und sie erfüllte diese Aufabe mit Erfolg, indem sie das Los mit der N° 367 zog – das war am Ende der 3. Etage und deswegen so besonders günstig, weil niemand daran vorbeifuhr und man das Fahrzeug bei Reparaturen wegrollen konnte, indem man einfach die Fahrbahn benutzte. Bei Witja in der Elektromontage-Verwaltung bestellten wir sogleich ein paar Metallschränke und einen Zwischenboden des weiteren verankerten wir zum Heben des Autos mittels Flaschenzug einen Haken im Eisenbetonträger in der Decke. Die ganze Box war 6 x 3 Meter groß, so daß das Fahrzeug und die beiden Schränke genau hineinpaßten. Zudem ließ sich seitlich noch ein Fahrzeuganhänger unterbringen, wenn man ihn hochkant auf die hintere Stoßstange stellte. Die zweiflügeligen Tore bestanden aus Netzwerk, damit im Fall eines Brandes der Park-Box das Feuer von außen mit Wasser löschen konnte. Insgesamt gesehen ließ sich die Garage durch Lufterwärmung gut beheizen, und zu Frostzeiten war es dort nie kälter als + 15°C.
Von dem Moment an, als wir das Auto erworben hatten, fingen wir an ständig im europäischen Teil Rußlands herumzureisen. Unsere erste Reise fand Anfang September 1973 in den Süden statt und führte uns durch d8ie Städte Orel, Charkow, Simferopol und Sewastopol und seinen Stränden am Ufer des Schwarzen Meeres, wo wir einen schönen Aufenthaltsort zum Haltmachen und Baden fanden. Wir durchfuhren die ganze Stadt mit ihren Museen und ihrer Festung. Wir besichtigten das Lastochkino Gnesdo (Schwalbennest; eine Miniaturburg als Wahrzeichen der Südküste der Krim; Anm. d. Übers.), fuhren die hochgelegene Bergstraße entlang und wären um ein Haar durch eine Kolonne zerdrückt worden, von der irgendein König gerade auf seinem Weg begleitet wurde. Wir konnten gerade noch mit Müh und Not rechts heranfahren und stehenbleiben, bis der gesamte Wagenzug vorübergefahren war. Wir nahmen Kurs nach Simferopol und weiter nach Moskau. Unterwegs sahen wir uns kurz den berühmten „Kursker Bogen“ an, wo im Juli 1943 die Schlacht mit den dreitausend Panzern stattfand, derengleichen die Geschichte der Menschheit kein zweites Mal erlebt hat. Während unsere Fahrt hörten wir im Autoradio, daß sich in diesen Tagen ein großer Staatsstreich in Chile ereignet hatte, daß der demokratische Präsident Allende bei der heroischen Verteidigung seines Landes in seinem Schloß ums Leben gekommen war. Diktator Pinochet hatte die Macht ergriffen.
Und so ging unsere erste weite Fahrt mit dem neuen Auto zuende. Dort, wo wir uns aufhielten, blieben die Leute immer stehen - sie wollten wissen, wie der Wagen genau konstruiert war und bewunderten seine schöne Form. Schließlich war dieses Modell N° 2103 das erste Massenmodell, das über eine für die siebziger Jahre hervorragende Qualität verfügte. Nun bereisten Witja und ich bekannte Gegenden. So verbrachten wir einige Zeit in der Sowchose „Budjonowez“, sahen das ehemalige Gutsbesitzer-Anwesen mit seinem zweistöckigen Herrenhaus, das inzwiswchen in ein unansehnliches Wohnheim umgestaltet worden war, und den schönen Hofgebäuden – in einem von ihnen hatten wir in den Jahren 1931-1932 gewohnt. Wir schauten uns auch das zweigeschossige, aus Ziegelsteinen gebaute Haus in der Ortschaft Wnukowo an, in dem wir 1932-1934 gelebt hatten. Wir freuten uns, daß nach nunmehr 40 Jahren diese für uns „heiligen“ Orte immer noch erhalten waren. Wir erinnerten uns an den Berg, den Elsa und Onkel Mischa im Winter mit Skiern hinabgefahren waren und ich zum ersten Mal erfahren hatte, weshalb sämtliche Gegenstände auf den Boden fallen und nicht in hängender Position in der Luft verharren. Die nächste Fahrt in diese Gefilde (Dmitrowsker Bezirk, Region Moskau) führte uns in die Ortschaft Rogatschowo – ein großer, ehemaliger Handelsplatz mit einer wunderschönen geräumigen Kirche. In diesem Großdorf lebte und unterrichtete vor dem Krieg meine Tante Emma Alexandrowna Gergenreder (die Schwester meiner Mutter, geb. 1902). Damals war uns lediglich bekannt, daß sie auf dem Kirchenterritorium im „Wärterhäuschen“ wohnte und daß diese Gegend im Winter 1941 vom Feind eingenommen worden war – und das war alles. Mit derartigem „Gepäck“ im Kopf fuhren wir nun durch das Dorf. Erhalten geblieben waren die ehemaligen Kaufmannshäuser mit den Verkauffständen in den ersten Etagen, im Zentrum die wunderschöne Kirchenumzäunung sowie die noch in Betrieb befindliche Kirche mit ihrem Glockenspiel. An allem, was man sah, ließ sich erkennen, daß das Dorf stets im Wohlstand gelebt hatte. Im „Wärterhäuschen“ waren keinerlei Spuren mehr von Tante Emma zu entdecken. Die neuen bewohner gaben uns lediglich den wertvollen Rat, doch einmal die Schule aufzusuchen, wo ein ehemaliger Frontsoldat als Heizer tätig wäre, der sich hier in der gesamten Gegen gut auskannte. Und tatsächlic: als wir uns dem Schulgebäude näherten, erblickten wir einen gerade aus dem Kesselhaus heraustretenden Mann in alter Soldatenuniform. Er erklärte uns sogleich, daß er sich an die Lehrerin Emma Alexandrowna noch sehr gut erinnern könne. Wir luden ihn ein, zu uns ins Auto zu steigen, und dann erzählte er uns folgendes: „ E.A. unterrichtete in den unteren Klassen, sie lebte mit ihrem Ehemann, einem Kriegsoffizier, und ihrem dreijährigen Kind zusammen. Mit Beginn des Krieges wurde ihr Mann sogleich zur Front einberufen; über sein weiteres Schicksal ist nichts bekannt, denn im Herbst 1941 wurde unsere Gegend hier vom Kriegsgeschehen bedroht. Die gesamte Bevölkerung wurde zum Ausheben von Schützen- und Panzerabwehrgräben mobilisiert. Die kleinen Kinder blieben elternlos zurück, ohne Aufsicht und Fürsorge. Damals kam E.A. mit den Eltern überein, 15 Kinder bei sich im „Wärterhäuschen“ aufzunehmen. Die Schule hieß diesen Vorschlag gut. Aber Krieg ist Krieg, und innerhalb einer Woche geriet das Dorf unter Feindesherrschaft. Die Situation im Dorf entsprach nicht mehr der Normalität. Sogleich tauchten eine Menge Denunzianten auf, welche alle Komsomolzen preisgaben, die dann von den Faschisten erschossen wurden (die Kommunisten befanden sich in der Armee). E.A., die der deutschen Sprache mächtig war, wurde von den Faschisten in Ruhe gelassen, zumal sie auch ihre 15 Kinder bei sich hatte. Eine Woche später vertrieb die Rote Armee die Faschisten aus dem Dorf, und nun mußte man mit ansehen, wie Provokateure noch vor dem Dorf unsere Armee in Empfang nahmen, indem sie sich vor ihren Opfern in Sicherheit brachten, indem sie sich jede Menge unwahre Geschichten zusammenschwatzten. Die Kinder blieben ohne „Mama“, aber das kümmerte niemanden, wichtig war nur, daß man wieder einen „Volksfeind“ aufgegriffen hatte. Natürlich wurde sie erschossen, denn eine andere Strafe existierte damals nicht“. So wurde dank dieses gutmütigen Schulheizers und Augenzeugen das Geheimnis um Tante Emmas Ende enthüllt, deren Familie bereits 30 Jahre zuvor aufgehört hatte zu existieren. Unserem Hüter der Erinnerung an Tante Emma überreichten wir zum Dank eine Schachtel Schokoladenkonfekt. Auf diese Weise war zu den bekannten Opfern der Familie Petri unter dem damaligen Regime noch ein weiteres hinzugekommen.