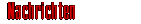

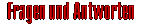



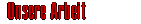




Nachdem unsere Schiffskarawane sich etwa 180 km weit von Igarka entfernt hatte, ging sie am 24. Juni 1942 bei der Siedlung Ust-Chantajka vor Anker, dort, wo das Autonome Tajmyrgebiet seinen Anfang nimmt. Hier ließen sie uns drei, zusammen mit der übrigen ersten Partei Sondersiedler (105 Personen) aussteigen: Deutsche von der Wolga und aus Leningrad, Letten, Esten und Finnen. Es war ein sonniger, warmer Tag. Da standen nun 105 Menschen am steinigen Ufer, die beim Ausladen vom Leichter mit Hilfe einer Schute einen für zwei Monate geplanten Vorrat an Lebensmitteln erhalten hatten: Tafelbutter, Zucker, Graupen, Schinken, Tee, Seife, Tabak, Streichhölzer. Das Mehl mußten wir zwei Wochen später an die Bäckerei abgeben. Die folgenden Partien der im Tajmyr-Gebiet eintreffenden Sondersiedler, und das waren insgesamt drei, bekamen eine derartige Lebensmittelversorgung; wie man sie uns zugesprochen hatte, nicht; sie waren von Anfang an dem Hungerdasein ausgesetzt, und somit waren viele von ihnen zum Sterben verdammt.
Ust-Chantajka – das waren alles in allem fünf Häuser: ein Geschäft der Fischerei-Kooperative, eine Bäckerei und drei Häuser für die Fischer, welche die Familien Mirgunow, Tschirkow und Grischko für uns geräumt hatten, und während Mama, Minotschka und ich am Ufer mit dem Bau einer Laubhütte beschäftigt waren, um uns möglichst schnell vor all den stechenden Insekten und Kriebelmücken in Sicherheit zu bringen, war Mama von den widerwärtigen Biestern bereits dermaßen zerstochen, dass ihr die Augen zuschwollen. Wir mußten ein Feuer entfachen und dadurch einen Rauchvorhang schaffen. Mit uns war auch die lettische Familie Jankowitsch ans Ufer gelangt: Natalia Viktorowna (Ärztin), Ruta (geb. 1922) und Jurij (geb. 1924). Auf Anweisung des Bezirksgesundheitsamtes in Dudinka wurde N.V. Jankowitsch bereits auf dem Leichter angekündigt, dass sie zur Leiterin der medizinischen Betreuungsstelle in Ust-Chantajka ernannt worden war und Ruta zur Krankenschwester. Während wir uns mit der näheren Umgebung vertraut machten, sammelten wir zahlreiche schmackhafte, wilde, grüne Zwiebeln; und in der Tundra waren bereits die Multbeeren und andere Beeren herangereift.
Nach einer Woche zogen wir in das Haus ein (18 qm), das zuvor die hiesige Fischerfamilie Grischko bewohnt hatte. Unsere vier Familien, die Petris, Wolfs, Maiers und Hinz’, bestanden aus insgesamt 12 Personen, die sich nun auf 14 qm einrichten mußten, den Platz für den Ofen abgerechnet. Am Haus gab es einen Windfang und eine Kammer zur Lagerung von Brennholz. Jede Familie stattete sich mit Pritschen aus; auch zwei Truhen kamen zur Verwendung. Für Mama und Minotschka wurde ein Mullvorhang gegen die vielen Mücken gespannt. Ich hatte mir bereits den Leuchtturm zueigen gemacht; ausgestattet mit Kissen und Decke konnte man dort oben ohne die störenden Blutsauger schlafen.
Die Schiffskarawane überließ uns zwei oder drei Ruderboote (sog. Astrachanboote), die sogleich zur Erkundung der Umgebung zum Einsatz kamen, vor allem der Inaugenscheinnahme des Sees und des kleinen Flüßchens, das in den Jenisej floß. Unsere Ankunft in Ust-Chantajka war zu einer Zeit erfolgt, als an den Ufern des Jenisej und des kleinen Flüßchens noch Schnee lag und sich stellenweise riesige Eisschollen, getrocknete Baumstämme und herangetriebene Holzabfälle des Igarsker Holzkombinats eingefunden hatten, d.h. mit Brennholz waren wir ausreichend versorgt. Ich fuhr mit Wladimir Wolf flußaufwärts bis zu einem Wasserfall, wo das Wasser aus einer Höhe von etwa 100 m herabrauscht. Hier kann man gut sehen, wie das Wasser sich seit Millionen von Jahren seinen Weg durch die kettenförmigen Reihen aus Steinen zum Jenisej bahnt. Die Eindrücke dessen, was wir dort sahen, blieben unvergeßlich. Die nördliche Natur hat besonders jetzt, im Frühling, ihren besonderen Liebreiz. Die Tag und Nacht am Himmel stehende Sonne zieht alles Lebendige ans Licht, damit es in den kurzen Polarsommern rechtzeitig seine Nachkommenschaft hinterlassen kann. Auf dem Rückweg zogen wir aus dem ins Flüßchen geworfenen Netz einen ziemlich großen Hecht. Das war unser erster Erfolg in der Ust-Chantajsker Fischwirtschaft.
Die gesamte, aus 105 Personen bestehende Bevölkerung der Siedlung wurde in Brigaden zu jeweils 15-16 Leuten eingeteilt, die anschließend in den vorhandenen Wohnräumen untergebracht wurden. Dazu gehörten auch drei Fischfang-Brigaden (die Brigaden von Eleonora Jorg, Anna Groo und Leo Petri) sowie zwei Bau-Brigaden (die von Adolf Kublik und Wladimir Schott). Mitte Juli wurden aus der Fischfabrik in Dudinka mit einem Motorboot drei Schleppnetze, „Püppchen“ (Schwimmer; Anm. d. Übers.) für die Netze und Trommeln mit aufgewickelten Tauen in Ust-Chantajka abgeliefert. Unter der Leitung des eingetroffenen Instrukteurs Bogdanow begannen nun alle drei Fischfang-Brigaden für sich 500 Meter-Schleppnetze aus Netzwerk von 35 mm Maschenweite zu „bauen“. Zwischen die Stangen wurde das obere und untere Schlepptau gespannt und daran dann ein Netzstreifen von 8 m Breite befestigt, das heißt die Höhe des Schleppnetzes im Wasser sollte 8 m betragen. Mir wurde eine Arbeit zuteil, mit er sich niemand sonst auskannte – aus dem Holz von Laubbäumen (beispielsweise Birken) Nadeln zum Netzeknüpfen zuzuschneiden, denn in jeder Brigade sollte es davon mehrere Stück geben. Ohne solche Nadeln, in die ein grober Faden eingefädelt wurde, konnte man die Netze nicht flicken oder ein zerrissenes Schleppnetz reparieren. Bei der Herstellung dieser Nadeln half mir ein nach der Verhaftung des Vaters im Jahre 1938 erhalten gebliebenes Klappmesser mit Perlmutt-Verzierungen. Sofern es scharfgeschliffen war, konnte man damit die komplizierte Form einer Nadel aus hartem, trockenem Holz mit Öse für den Faden ausschneiden. Nachdem ans obere Ende des Schlepptaus aus trockenem, gebrannten Holz jeden Meter ein Schwimmer und an die untere Schnur Senkbleie genäht worden waren, wurde es verladen und der Fangkorb zusammengezogen – das Netz war nun einsatzbereit. In jenen Jahren, als für die Herstellung der Netze Baumwollgarn verwendet wurde, war es unbedingt erforderlich die Netze vor der Benutzung nit einem Mittel gegen Fäulnis zu tränken. Die heutigen Nylonnetze benötigen eine derartige Prozedur nicht.
Bogdanow kündigte an, dass wir das Schleppnetz morgen, am 9. Juli, erproben wollten; er ernannte dazu acht Jungen und Mädchen, die sich auf diesen Tag entsprechend vorbereiten sollten. Als Brigadeführer und „astrachaner Fischer“ kam ich ebenfalls mit auf die Liste. Am Morgen versammelten wir uns, und nachdem wir das Schleppnetz ins Fischerboot geladen hatten, begaben wir uns ans linksseitige, sandige Ufer des Jenisej. Die im Boot sitzende Jugend stammte hauptsächlich aus den Steppengebieten der Wolga; deswegen setzte sie beim Anblick der Wellen das Boot sogleich auf Grund – sie mußten sich erst an das Schlingern gewöhnen. Als wir am Fangplatz angekommen waren, wurde uns klar, dass sich unser Anweiser mit der Technologie des Fischfangs mit einem großen Schleppnetz schlecht auskannte, weil er in der Folgezeit eine Menge Fehler durchgehen ließ: der Fangplatz war zuvor nicht mit Hilfe eines Seils von untergegangenem Strandgut und Steinen gesäubert worden, und deswegen hing das Netz bereits beim ersten Einholen fest und zerriß; aufgrund der schlechten Unterweisung wußte der Fischer an seinem Platz nicht, wie er das Schleppnetz festhalten sollte, damit es nicht mit der Strömung in den Fluß hineingezogen wurde – er, der Bedauenswerte, der bemüht war, so gut es ging mit seinen Händen das Netz zu halten, wurde bis über die Gürtellinie ins Wasser hineingerissen und ließ die Schnur los; nachdem er ans Ufer gelangt war, war er gezwungen, den Stock, den er bei sich hatte, fest in den Sand zu stoßen, um das Schleppnetz eine Schnurlänge vom Ufer entfernt zu halten; infolgedessen wurde das Schleppnetz mit der Strömung in die Tiefe gerissen, verhedderte sich, und wir mußten es ans Ufer ziehen; indessen war der Fischer an seinem Arbeitsplatz vollkommen durchnäßt. Auch wenn das Einholen des Netzes nicht erfolgreich gewesen war, befanden sich im Fangkorb mehrere große Weißlachse und Tajmenlachse. Wir freuten uns alle sehr darüber, denn dieser Erfolg versprach ein Mittagessen, bei dem alle sich sattessen konnten. Vollkommen durchnäßt, aber zufrieden mit ihrer Beute, begaben sich alle zum Trocknen ihrer Sachen in die Fischerkate mit den zweistöckigen Pritschen und dem Eisenofen. Da wir zu dem Zeitpunkt noch keine Tüllvorhänge besaßen, ließen uns die beißenden und stechenden Insekten nicht zur Ruhe kommen. In dieser Hinsicht waren der Juli und die erste Augusthälfte im Norden die unangenehmste und unruhigste Zeit – es war unmöglich, sich an diese gräßlichen Kreaturen zu gewöhnen. Tagsüber, während der Arbeit mußte man eine Schirmmütze mit einem Tüllnetz darüber tragen (Gaze war ungeeignet, denn man keuchte darunter vor Hitze, Schweiß und schlechter Luftzufuhr), und nachts hätten eigentlich alle Bettstellen in ihrer gesamten Länge mit einem Gazevorhang verhängt werden müssen. Aber keiner besaß so etwas, außer unserem Instrukteur.
Als wir vom Fischfang in unsere Kate zurückkehrten, stellten wir mit Schrecken fest, dass wir am Morgen bei unserer Abfahrt aus der Siedlung am Ufer, zwischen den Steinen, unsere Bündel mit Essen liegengelassen hatten – vor allem unser Brot. Während wir uns in der Kate trocknen ließen, wütete auf dem Jenisej ein heftiger Sturm, der ganze Fluß war mit weißen Schaumkronen bedeckt, und es war viel zu gefährlich, um mit dem Boot loszufahren und das Brot zu holen; daher beschlossen wir, unsere Mahlzeit nur mit dem gefangenen Fisch zu bestreiten.
Am vierten Tag hatte sich der Sturm über dem Fluß immer noch nicht gelegt.
Was sollten wir tun? Der Fisch für unsere Mahlzeiten war bereits ausgegangen,
der Himmel mit schwarzen Wolken bedeckt – es weht ein scharfer Nordwind. Außer
dem Fischerboot, mit dem wir das Schleppnetz auswarfen, besaßen wir noch ein
kleines Boot – eine Astrachanka – mit zwei Rudern. Bogdanow will wissen: wer ist
freiwillig bereit, zu dritt mit dem Boot die 7 km bis zur Siedlung zu fahren, um
Lebensmittel zu holen? Es fanden sich drei: Bogdanow am Heck des Bootes als
Steuermann, Petri und Jankowitsch an den Rudern. Der Sturm war in der Tat
heftig, das Boot schleuderte auf den Wellen hin und her, mal sauste es bis an
den Fuß der Welle hinab, mal stand es auf einem Wellenkamm, wo der gefährlichste
Augenblick der ist, in dem sich das Wasser ins Boot ergießt. Unser Steuermann
kannte sich mit allem hervorragend aus, einschließlich dem Herausschöpfen des
Wassers aus dem Boot mit einem Eimer. In der Mitte des Jenisej sahen wir, dass
die gesamte Siedlung ans hochgelegene Ufer gekommen war, um uns zu beobachten,
was uns natürlich mehr Mut machte, und als wir schließlich in das kleine
Flüßchen einbogen – da kamen alle zur Begrüßung zu unserem Boot
herabgelaufen und bewunderten unsere kühne Fahrt. Während wir Lebensmittel
erhielten und zu Mittag aßen, wurde der Sturm über dem Fluß merklich ruhiger und
die „Schneehasen“ (Gischt, Schaumkronen; Anm. d. Übers.) verschwanden. Wir
machten uns auf den Rückweg, nun allerdings nur noch zu zweit – Jura Jankowitsch
war krank geworden. An den Fangplatz zurückgekehrt, nahmen uns unsere
„hungrigen“ Fischer mit Freude in Empfang.
Nach dem ersten Versuch mit dem Schleppnetz zu fischen, wurde den drei Brigaden ein solches ausgehändigt, zudem Haken zum Trocknen und Netzeflicken sowie je Schleppboot, ein 30 m-Zelt, ein Eisenofen, ein Teekessel, ein großer Kochkessel zum Zubereiten von Fischsuppe und eine Bratpfanne; außerdem erhielten sie einige geflochtene Körbe zum Tragen der Fische. All diese zum Fischfang notwendige Ausrüstung bekamen wir von der Fischfabrik in Dudinka, denn bis zu dem Zeitpunkt waren wir Fischer des staatlichen Fischerei gewesen. Die gesamte Fischausbeute lieferten wir an Sujew, den Leiter der Fischannahmestelle ab und erhielten dafür von ihm Rulons für den Bezug von Lebensmitteln und Industriewaren sowie Geld. Der Ankaufpreis für den bei der Fischabnehmerin der Fischfabrik abgegebenen Fisch war in jenen Jahren, verglichen mit dem Einzelhandelspreis in den Geschäften, äußerst niedrig und hing stark von der Fischart ab: Stör – 3,70, Weiß- und Tajmenlachs – 2,70, große Maränen und Schnäpel – 2,10, Omul – 1,60, Zwergmaränen (der sogenannte „Turuchansker Hering“), Stinte (die sogenannten „Seewölfe“) – 1,10, schwarzer Kleinkram (Aalquappen, Rotfedern, Flußbarsche usw.) – 0,15.
Meine Fangbrigade (die „Petri-Brigade“) bestand aus 16 Leuten – 2 Einheiten mit jeweils 8 Fischern (4 Jungs und 12 Mädel). Am Fangplatz (der 3 km lang und Teil des gesäuberten Ufers war und an dem der Fischfang mit einem Schleppnetz getätigt wurde) errichteten wir für unsere Brigade ein Zelt, dichteten es gegen die heftigen Winde ab, zimmerten aus grobem Holz Pritschen zusammen, auf die wir mit Gras ausgestopfte Matratzen legten. Später brachten wir aus der Siedlung unser eigenes Bettzeug mit und erhielten auf diese Weise eine recht leidliche Behausung mit weitem Ausblick auf den Fluß. Als Brennholz benutzten wir am Ufer herumliegendes, havariertes Trockenholz. In der Brigade herrschte, so lange wir bis August 1942 dem staatlichen Fischfang angehörten, völlige Gleichheit, das heißt alle erarbeiteten Rulons, aber auch das verdiente Geld, wurde zu gleichen Teilen verteilt, unabhängig davon, wieviel jeder einzelne zur Arbeit beigetragen hatte. Innerhalb der zwölf täglichen Arbeitsstunden gelang es, das 500 m-Schleppnetz viermal im Wasser auszuwerfen. Die Zeit für das Mittagessen zählte ebenfalls dazu. Frühstück und Abendessen fanden dagegen außerhalb der Arbeitszeit statt. Gegen Ende des letzten Fangvorgangs mit dem Schleppnetz schickte jede Einheit zwei ihrer Mädchen los, um das Mittagessen sowie Tee für Frühstück und Abendessen vorzubereiten. Einmal pro Woche war die Brigade gzwungen, das Netz zum Trocknen an Haken aufzuhängen, wobei sie gleichzeitig die Maschen flickte sowie verlorengegangene Schwimmer und Senkbleie ersetzte. Für diese Prozedur war eine ganze 12-stündige Schicht notwendig. Einmal in zwei Wochen fuhr die Brigade in die Siedlung Ust-Chantajka zum Badehaus. Das war für uns ein Festtag: Treffen mit den Eltern, Erfahren der letzten Ereignisse im Lande; mitunter erhielten wir dort auch Zeitungen und Zeitschriften und sogar Bücher, die uns dann bei einer günstigen Gelegenheit Mitarbeiter des Bezirkskomitees schickten. Rundfunkempfang und Elektrizität gab es in der Siedlung nicht. Einmal brachten sie einen Film – da kurbelten dann die Männer während der gesamten Vorführung im Wechsel per Hand an einem Elektrogenerator, aber den Film „Die beiden Kämpfer“ schauten wir uns bis zum Schluß an. Nach dem Bad versammelte sich die gesamte Fischerjugend für gewöhnlich im Kontor, wo die Mädchen deutsche Lieder sangen; besonders traurig klang unter der Begleitung eines Akkordeons das Lied über die von uns verlassene Heimat; unsere Eltern lauschten ihm, und ihre Augen füllten sich dabei mit Tränen. Tanzveranstaltungen gab es vorerst noch nicht – es gab nicht genügend Platz; sie begannen erst am 1. Mai 1943, als das fünfwandige Kontorhaus fertiggestellt war.
Den Fisch lieferte ich bei der Abnehmerin immer gemeinsam mit einem der anderen Jungs ab; dazu mußte man mit dem Ruderboot 3 km weit fahren. Ich war der Sache schon überdrüssig, und so nähten wir aus Säcken eine Art Segeltuch zusammen und bastelten daraus für unser Boot mit den beiden Rudern ein dreieckiges Segel, so wie sie es auch in Astrachan haben. Wir waren die Allerersten, die mit einem Segelboot in Ust-Chantajka verkehrten. Entlang des Ufers jagten wir mit einer Geschwindigkeit dahin, mit der rennende Hunde nicht hätten mithalten können. Wenn wir jetzt unseren Fisch bei der Abnehmerin ablieferten, war das für uns das reinste Vergnügen. Sujew war begeistert, denn nun entstanden bei der Fischabgabe keine Verzögerungen mehr – bei uns gab es immer Wind aus südlicher oder nördlicher Richtung.
Der Finne, der an der Anlegestelle in Krasnojarsk Probleme mit seinem Paß gehabt hatte, war mit uns nach Ust-Chantajka gelangt, gehörte jedoch aus irgendeinem Grunde zu keiner der gebildeten Arbeitsbrigaden. Er war alleinstehend, trug nur leichte Kleidung, machte einen seelisch niedergedrückten, gedemütigten Eindruck, und er kannte sich auch mit der russischen Sprache nicht gut aus. Er ging in die Tundra und sammelte dort Pilze, Multbeeren, Hedelbeeren, schwarze Johannisbeeren und Hagebutten. Man merkte, dass er Vorkehrungen für den Winter traf. Und dann begann dieser Mann sich neben unserem Haus, wie viele andere auch, am abfallenden Ufer des Flüßchens eine Erdhütte zu bauen.
Im Herbst, bei der Zustellung der Lebensmittel in den Norden, zog die Bezirksbehörde für das Abladen der Schuten die Fischer heran. Dabei verhielt sie sich uns gegenüber voller Haß und Feindseligkeit. Ein Vorfall ist in der Erinnerung geblieben, als beim Abladen der schweren Säcke mit Mehl (70 kg) vom Frachtraum auf das Fallreep, und von dort ans Ufer, der Vorsitzende des Bezirksexekutivkomitees in Dudinka, Mikow, uns Fischer und Ladearbeiter anbrüllte: „Bewegt euch, Faschisten, sonst jage ich euch allesamt nach Nor-r-r-r-ilsk!“ Natürlich konnten wir Jungchen und Mädelchen, nicht wie ausgewachsene Männer und professionelle Ladearbeiter derart schwere Lasten schnell und sicher auf dem schwankenden Fallreep vorwärtsbewegen, aber so eine Einstellung uns gegenüber war unverdient. Die Karriere dieses Akteurs war schnell beendet; sobald die ersten demobilisierten Frontkämpfer 1946 in den Norden zurückkehrten, wurde er Arbeiter in einem Lagermagazin beim Bau.
In Anbetracht der Bevölkerungsgröße der Siedlung ergriff die Leitung der Kolchose, die im August 1942 organisiert worden war (Vorsitzender und Mitglied der WKP (B) E.Erdman), in aller Eile Maßnahmen zum Bau neuen Wohnraums, denn die neu eingetroffene Partie von 210 Personen besaß überhaupt kein Dach über dem Kopf, und der Nordsommer sollte in einem Monat zuende gehen (3 Monate Sommer, 9 Monate Winter). Entlang des rechten Flußufers begannen die Menschen getrocknete Baumstämme vom Ufer ins Wasser zu rollen und in Richtung der Siedlung zu treiben; dort wurden sie unter größten Anstrengungen von den Frauen ans höher gelegene Ufer gewuchtet, wo sich die eigentlichen Bauplätze befanden. Für zwei Fünfwandhäuser wurden die Grundsteine gelegt. In einem der beiden Häuser wurde der halbe Raum als Kolchoskontor mit zwei Zimmern eingerichtet (das Kabinett für die Vorsitzende und die Buchhalterin und eines für Publikumsverkehr). Die andere Hälfte des Hauses wurde zum Wohnraum mit Pritschen. Das zweite Haus - eine richtige Baracke mit zweistöckigen Pritschen aus unbearbeiteten Birkenstangen – erwies sich bei Einsetzen der Kälte im September als wahrlich ungesunde und stickige Behausung, denn sie war von hoffnungslosen Menschen total überfüllt. Denn am 19. September 1942 hatte das Motorschiff „Sergo Ordschonikidse“ in Ust-Chantajka noch eine dritte, die letzte, Partie Sondersiedler abgeliefert – insgesamt 135 Personen. Die Bevölkerung der kleinen Siedung wuchs auf 450 Bewohner an. Die bereits erwähnte Baracke war überbelegt, es mangelte an Wohnraum; jeder Bewohner hatte auf seiner Pritsche einen Platz von nicht mehr als 0,5 m zur Verfügung. Aufgrund von Erkältungskrankheiten und Hunger hatte, besonders unter den Kindern der eingetroffenenen zweiten und dritten Partie, bereits ein Massensterben eingesetzt. Und das war auch gar nicht verwunderlich, denn beim Verlassen des Dampfers hatten diese Menschen keinen Lebensmittelvorrat und kein Geld erhalten – sie waren wirklich und wahrhaftig dem Tod ausgesetzt worden. Zudem war die dritte Partie dort bereits mit schweren Erkältungserscheinungen und anderen Erkrankungen angekommen, und das betraf vor allem die Kinder. Es stellte sich heraus, dass der Passagierdampfer mit den beiden Decks überbelegt gewesen war, und das gesamte Sonderkontingent bereits in Krasnojarsk auf den Decks, unter freiem Himmel, der „Gnade“ den herbstlichen Gegenwinden und des Nebelschwaden ausgesetzt gewesen war. Alle Kajüten und Salons waren mit gewöhnlichen Passagieren belegt, die im Besitz regulärer Fahrkarten waren. Und dann, als das sogenannte Sonderkontingent nach dem gefährlichen, unmenschlichen Transport, ohne warme Kleidung, in Ust-Chantajka angekommen war, fanden sie sich plötzlich ohne schützendes Dach über dem Kopf, unter freiem Himmel wieder, das heißt, um es mit den Worten W. Wysozkijs zu sagen: vom Schiff „direkt ins Grab“. Und so geschah es auch – auf der einen Seite mußten unverzüglich Erdhütten gebaut werden, auf der anderen sollten die Flöße mit dem Baumaterial abgeladen werden, um durch Arbeit die nötigen Lebensmittelmarken zu verdienen. Das waren Sklavenbedingungen, unter denen die 2. und 3. Partie der Neuankömmlinge im August und September 1942 leben mußten. Ganz besonders hatten die Balten zu leiden, die in der Regel keinerlei wärmende Kleidungsstücke besaßen.
Der Jenisej war 1942 am 17. Oktober bereits zugefroren. Zu diesem Zeitpunkt hatten die „fürsorglichen“ Behörden aus Igarka einige Flöße mit fertig montierten Zweiwohnungshäusern, gesägten Balken und Brettern nach Ust.Chantajka, Potapowo, Nikolskoje und in andere Siedlungen geschickt, die nun innerhalb kürzester Zeit im Eis des Jenisej festgefroren waren. Natürlich begriffen alle, dass es nun galt, dies Baumaterialien so schnell wie möglich in Sicherheit zu bringen, denn mit dem nächsten Eisgang im Frühling würden sie vernichtet werden. Es begann eine viele Monate dauernde Arbeit des Herausmeißelns und mühsamen Fortschleppens der Baumaterialien auf den Schultern der Frauen ans hochgelegene Ufer, in die Siedlung. Diese armen Frauen konnte man nur mit den Winterflüchtlingen aus der Zeit des 2. Weltkriegs vergleichen: warme Kleidung und Schuhwerk wurden durch Säcke an Beinen und Schultern ersetzt, und das bei Temperaturen von –30 bis –40 Grad. Die Menschen begannen massenweise zu sterben.
Die ganze Last der Hilfeleistung für diese Menschen entfiel auf die Familie unserer Ärztin Natalia Viktorowna Jankowitsch, Tochter Ruta, welche die Aufgaben einer Krankenschwester erledigte, sowie Sohn Jurij. Sie hatten in einer zuvor am Ufer gebauten Erdhütte eine gute medizinische Betreuungsstelle mit zwei Räumen eingerichtet – einem Wohnraum und einem Sprechzimmer für die Kranken. Die tapfere, fleißige und hochgebildete Frau aus Riga, N.V. Jankowitsch, besuchte täglich alle Wohnhäuser, Baracken und Erdhütten und half den Kranken, die unter so furchtbaren Bedingungen ihr Leben fristen mußten. Sie organisierte das Sammeln von Tannennadeln und ließ daraus ein Gebräu zur Heilung von Skorbut herstellen. Jeder Kranke war verpflichtet täglich ein Glas von diesem sehr bitteren grünen „Gift“ zu trinken. Diese lettische Familie war im Juni 1941 aus der Stadt Daugawa in den Pirowsker Bezirk, Region Krasnojarsk, verschleppt worden, und im Juni 1942 nach Ust-Chantajka. Der Vater wurde 1941 als „Volksfeind“ in Lettland erschossen. Das war das Los der meisten Familien aus dem Baltikum.
Der Finne, von dem wir bereits gehört haben, beendete unter dem Fester unseres Hauses den Bau seiner Erdhütte – er hatte es noch rechtzeitig vor dem Einsetzen des ersten Frostes geschafft. Zu den Kolchosarbeiten erschien er nicht, ich traf ihn allenfalls im Laden, wo er seine Ration für nicht arbeitende Familienmitglieder bekam. Diese Ration reichte ihm nicht, und so fing er damit an, allen, die das Geschäft betraten, seine importierte, wunderschöne Armbanduhr gegen einen Laib Brot anzubieten; es fanden sich jedoch keine Käufer. Als das Eis zu einer dicken Schicht zusammengefroren war, gingen die Fischer zum Eisfischen von Renken über, die in dieser Zeit anfangen zu schwärmen. Die Kunst des Fischfangs unter dem Eis hatte uns der Instrukteur der Fischfabrik, der ortsansässige Nenze Bolin, sehr gut beigebracht. Die Petri-Brigade stellte stellte am rechten Ufer quer durch den Jenisej zwei Reihen mit insgesamt zwanzig Netzen auf. So hatte es uns Bolin empfohlen, wobei er uns gleichzeitig die ganze Technologie dieser Fangart erklärte. Nach Ablauf eines Tages mußten die Netze kontrolliert werden, denn sonst hätten sie sich durch Schlamm und Fische, wie beispielsweise Aalquappen, verdreht; wir mußten also jeden Tag eine Reihe mit zehn Netzen begutachten. Aber als mühsamste Arbeit erwies sich alle zehn Tage der Austausch der Netze gegen neue, saubere, trockene und geflickte Netze. Um die Netze zu trocknen, hatten wir aus Brettern eine Art Schuppen errichtet, den wir beheizten und dann mit Hilfe eines eisernen Ofens ein „Bad“ für sie organisierten. Danach nahmen wir sie mit „nach Hause“, wo wir sie flickten. Das war für uns eine Arbeit im Warmen. Wir hatten gelernt, an den kleinen runden Eislöchern Stroganina (gehobelten, rohen Fisch; Anm. d. Übers.) zuzubereiten und zu essen. Dadurch wurde nicht nur unser Hunger gestillt, sondern es stellte auch eine „Medizin“ gegen Skorbut dar. Im Winter hatten wir ein schweres Fischerlos zu tragen, denn wir hatten nur leichte Schlitten, mit denen wir die gefrorenen, schweren Netze zum Trocknen und Flicken, die Stangen zum Aufeisen und die Fische abtransportierten. Die ganze Arbeit fand auf dem offenen Eis statt, wo man dem scharfen Wind und dem grimmigen Frost schutzlos ausgesetzt war, und die Hände sahen aus wie „Adlerkrallen“. Alles mußten wir selber bis zu einer Entfernung von etwa 3 km hin- und zurücktragen. Sobald unsere Brigade sich auf dem Eis der Siedlung näherte, da tauchte am erhöhten Ufer auch schon die Gestalt des Hauptbrigadiers über alle Fischfangbrigaden auf, der nur das einzige Ziel verfolgte - aufzupassen, dass niemand auch nur einen Fisch mit nach Hause nahm, denn der gesamte Fang mußte an Sujew abgegeben werden. Einmal sah ich wie meine Mädels in ihren Rentierschuhen und unter den Gürteln Renken verbargen – denn die Familie zuhause litt Hunger. Zum Kochen und Braten gab es keine Möglichkeit, denn in den völlig überfüllten Baracken und Häusern fanden sich schnell Neider, die bereit waren, einen bei der Verwaltung zu denunzieren. Eine Familie wurde wegen Fisch-„Diebstahls“ zu zwei Jahren verurteilt und ins Norillag gebracht. Daher gab es nur einen Ausweg: man mußte den Fisch gleich an den Eislöchern oder Zuhause hobeln und roh essen. Später schickte die Familie aus dem Norillag einen Brief, in dem sie mitteilte, dass sie im Gefangenenlager erheblich besser gehalten würden, als sie es in Ust-Chantajka hatten erleben müssen, wo sie sich stets am Rande des Todes bewegt hatten. Jetzt war ihre Verpflegung gesichert – und warmer Wohnraum auch. Man muß eingestehen, dass die sogenannte zielbestimmte Versorgung mit Lebensmittel-Rulons für die Fischer von Vorteil war, denn ein Fischer allein konnte seine Familie (2-3 Personen) mit Nahrung unterhalten. Als jedoch die Kolchose gegründet wurde, da wurden von uns Fischern 40% der Rulons und des Geldes einbehalten und flossen in den Kolchosfond.
Man kann nicht sagen, dass die Bezirksbehörden in Dudinka im Hinblick auf die tragischen Ereignisse, die sich in Ust-Chantajka abspielten, nicht auf dem Laufenden waren; sie wußten das alles, denn sie besuchten uns oft, hielten unter dem Motto „Mehr Fisch für die Front“ allgemeine Versammlungen ab, unterhielten sich im Kontor mit der Kolchosleitung – und damit war die Sache für sie erledigt. Wie kann man mit der Situation einverstanden sein, in der sich die meisten (70%) Sondersiedler befanden, die lediglich eine Essensration für nichtarbeitende Familienangehörige erhielten und deren Familien nach und nach aufgrund von Hunger ausstarben? Und dieser Untergang der Mensch ereignete sich ausgerechnet am Ufer des fischreichen Jenisej. Lediglich der Vorsitzende des Staatlichen Tajmyrer Fischkonzerns und Leiter der Produktionsabteilung (später wurde er Chef des Konzerns) Jerschow ordnete an, auf Lebensmittelkarten Fisch auszugeben, den wir an Sujew abgaben.Alle anderen Behörden“-Vertreter“ zuckten nur mit den Achseln, während in der Bäckerei für sie schon die nächste Portion Fisch gebraten wurde. Es war höchste Zeit, dass man dem in größter Armut lebenden Volk Essensrationen gemäß Arbeitsnorm zubilligte, denn man mußte die Leute schnellstens aus ihrer elenden Lage herausbringen. Aber nichts geschah; die Kolchos-Leitung erwies sich als schwach und willenlos und beobachtete stillschweigend, wie Tag für Tag die Toten im Schnee begraben wurden.
Bei einem ihrer Rundgänge teilte mir die Ärztin N.V. Jankowitsch mit, dass unser Nachbar, der Finne, in seinem Erdhütten-Grab erfroren sei. Da er weder Axt noch Säge besessen habe, sei er nicht in der Lage gewesen, sich Brennholz zu beschaffen. Offenbar war er ein hochgebildeter Mann gewesen, der sich bei der Ärztin seinen ganzen Kummer von der Seele geredet hatte – umgebracht hatte ihn das, was Major Owtschinnikow ihm an der Anlegestelle in Krasnojarsk angetan hatte. Dieser Finne hatte noch vor der Entstehung der Karelisch-Finnischen ASSR die Universität in Helsinki absolviert und war als Schullehrer auf den Gebieten Physik und Astronomie tätig gewesen. Warum war er in keine der Arbeitsbrigaden hineingeraten? Es kam heraus, dass er ein schwerkranker Mann war, der keine schweren körperlichen Arbeiten auf dem Bau, beim Fischfang u.ä. verrichten konnte. Da er alleinstehend war, hatte er irgendwann seine Willenskraft verloren und auch nie mit jemandem darüber gesprochen. Dieser dem Tod geweihte Mann tat uns in der Seele leid. Natalia Viktorowna sah sich mit der Tatsache konfrontiert, daß sie nun die Tür seiner unbeheizten Semljanka hatte öffnen müssen. Dort hatte sie den in einer unnatürlichen Position neben Felssteinen liegenden Mann, der bereits erkaltet war, gefunden. So endete in jenem Winter 1942-1943 das Leben vieler in Ust-Chantajka. Es war ein Totenhaus, ein Genozid an unschuldigen Menchen.
Unsere Brigade war von allen Fischerbrigaden in Ust-Chantajka die beste, und so wurde ich als Brigadeleiter vom Kolchosvorstand zur regionalen Konferenz der Tajmyrfischer nach Dudinka abkommandiert. Für mich war das eine große Ehre und Freude. Aus dem Vorratslager der Kolchose erhielt ich für unterwegs warme Kleidung aus Rentierfell: einen Pelzmantel, Rentierstiefel u.ä. In dieser warmen Kleidung verbrachten der Schlittenführer und ich auf dem Weg nach Dudinka bei heftigem Schneesturm und minus 20 Grad eine Nacht in der Tundra. Vollkommen vom Schnee zugeweht schliefen wir in Ruhe aus, während die Rentiere in der Nähe weideten und unter dem Schnee ihr Futter fanden – Moos und Rentierflechten. Ein Rentier versteht sehrwohl, dass sich das Futter in der Tundra unter seinen Beinen befindet, und dass es unter dem Eis des Jenisej Wasser gibt. Deswegen laufen die Rentiere, wenn ihr Gespann „hungrig“ ist, in der Tundra viel fröhlicher einher. Die Fahrt mit den Rentieren war äußerst interessant. Die Konferenz fand im Klubhaus des Hafens statt. Für mich war alles neu; es gab sogar ein Konzert, auf dem ein Blasorchester spielte. Die Konferenz wurde unter der Losung „Mehr Fisch für die Front“ abgehalten, denn der Fischfang-Plan für das Tajmyr-Gebiet insgesamt war nicht erfüllt worden. Über die Sondersiedler und ihre Probleme fiel während der Veranstaltung kein einziges Wort. Nachdem wir uns noch einige der letzten Ausgaben der Zeitschriften „Ogonjok“ („Flämmchen“; anm. d. Übers.) und „Krokodil“ besorgt, aber auch Briefe, Pakete und aus Potapowo einen Teil der Lebensmittel für den Laden verstaut hatten, kehrten der Hundeschlittenführer (ein ortsansässiger Nenze) und ich mit den beiden Schlitten nach Ust-Chantajka zurück. Unterwegs übernachteten wir zweimal – in Sitkowo im Kontor der Kolchose und in Potapowo bei den Tschirkows, die uns sehr freundlich aufnahmen und uns zum Abendessen mit Fisch und Tee bewirteten. Die ganze Nacht hindurch weideten die Rentiere selbständig draußen in der Tundra, in der Nähe von Potapowo. Am nächsten Tag sollten wir bis nach Hause eine Entfernung von 70 km zurücklegen. Mitunter hielten wir an, um die Rentiere ein wenig verschnaufen zu lassen. Wir näherten uns bereits Ust-Chantajka, als unser Leittier plötzlich nach rechts ausbrach. Was war geschehen? Wir fuhren doch über das Eis des Jenisej und waren zuvor auf keinerlei Hindernisse gestoßen. Die Antwort bekam wir am Morgen, als wir sahen, dass wir geradewegs über eine offene Stelle gefahren waren, die aufgrund eines Wasserwirbels nicht zugefroren war. Wir waren nämlich mitten in der Nacht gefahren, und da konnte der Schlittenführer den Dampf, der vom Wasser aufstieg, natürlich nicht sehen, aber das kluge Rentier witterte das Wasser und drehte in einer jähen Wende von dem Eisloch ab (für dieses Verhalten belohnte ich es am Morgen mit einem kleinen Stück gesalzenen Brotes), was an den Schlittenspuren im Schnee gut zu erkennen war. Es wurde klar, dass der Jenisej auch im Winter recht tückisch sein konnte. Das war in meinem Leben der zweite Fall, in dem mein Tod bereits mit einer annähernd hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit feststand.
Der 1. Mai 1943 war für mich ein denkwürdiger Tag – meine Tante Minna brachte mir das Tanzen bei. Das geschah in den Räumen des Kontors, in denen dieser Tag begangen wurde. Unter den Klängen des Akkordeons lernte ich schnell, wie man Walzer, Tango und Foxtrott tanzt. Man konnte sehen, wie sehr sich die Jugend nach dem Tanzvergnügen sehnte, vor allen Dingen nach Volkstänzen. Nur eine Sache war schade – das Kontor war zu klein, um alle Interessenten, die sich dort zum geselligen Beisammensein eingefunden hatten, unterzubringen.
Gute Hilfe im Baubereich leistete der Kolchose „Nordweg“ das „Bootsfahrer“-Kommando (wie man die Männer in der Siedlung liebevoll nannte), das auch schon während des Eisgangs und der Zeit des Eisschlamms nicht mehr geschafft hatte, bis nach Igarka durchzukommen und deswegen gezwungen war, sein Boot in unserem Flüßchen zur Überwinterung festzumachen, mit der Überlegung, dass sie sich im Frühjahr mit dem Hochwasser bis zum Eisgang im Flüßchen verborgen halten konnten. Das Kommando, mit seinem Kapitän an der Spitze, zog mit insgesamt fünf Mann selbst die Baumaterialien von dem im Jenisej festgefrorenen Floß und bauten daraus ein Haus mit zwei Wohnungen, in dem eine Hälfte der medizinischen Betreuungsstelle, die andere als Unterkunft für sie selbst gedacht war. Im darauffolgenden Jahr wurde das gesamte Haus der medizinischen Versorgungsstelle überlassen. Zum Frühjahr 1944 wurde in der Zehnwohnungsbaracke vom Bezirksgesundheitsamt Dudinka für verwaiste Frontkämpfer-Kinder eine „Waldschule“ eingerichtet. Unter den Erzieherinnen der Schule befand sich auch Viktoria Walter. An den freien Tagen wurde eines der Zimmer dieser Baracke zum „Klubraum“ umfunktioniert, in dem Tanzveranstaltungen organisiert und die allgemeinen Versammlungen der Kolchosarbeiter durchgeführt wurden. Unter den Bootsleuten fand sich ein Bajan-Spieler, an dem sämtliche Tänze „schwebten“. Der Bootskapitän erwies der Bevölkerung der Siedlung große Hilfe – er stellte aus seinen Vorräten Brennmaterial zur Verfügung, wodurch die Menschen die Möglichkeit erhielten, ihre bislang mit Kienspänen zustandegebrachte Beleuchtung auf Kerosinlampen und Öllämpchen umzustellen.
Nachdem in Ust-Chantajka die Kolchose „Nordweg“ organisiert worden war, tauchte eine neue Verwaltung auf, es gab zusätzliche Wirtschafter, beim Bau erschienen Vorarbeiter, und bei den drei Fischfangbrigaden ein freigelassener Brigadeleiter. Alle diese Neuerungen verlangten zusätzliche Ausgaben – von den Fischer-Rulons und den Geldeinkünften wurdennun 40% ins Kolchosbudget abgeführt. Im Jahresdurchschnitt betrug die Fischfangquote der Kolchose „Nordweg“ 450 Zentner. Eine derartige Ausbeute bewerkstelligten drei Brigaden mit insgesamt 48 Mann.
Gegen Ende 1942 wurden an der Station Ust-Chantajka Sondersiedler in einer Größenordnung von 450 Personen abgesetzt, und zwar, sagen wir es ruhig gerade heraus – zum Sterben, denn für dieses Kontingent gab es in der Kolchose „Nordweg“ keinerlei Arbeit. Grundlegendes Dokument für die Massenumsiedlung der Menschen in den Hohen Norden war die am 6. Januar 1942 verabschiedete Anordnung des Rates der Volkskommissare der UdSSR „Über die Entwickung der Fischindustrie in den Flußbecken Sibiriens und des Fernen Ostens“. Das Land brauchte Fisch, und die Front ebenfalls. Im selben Jahr wurde der „Staatliche Tajmyrer Fischfang-Konzern“ von Igarka nach Dudinka verlegt, der sich vorwiegend aus Astrachanern zusammensetzte, hoch qualifizierten Spezialisten des gewerblichen Fischfangs, unter denen sich auch der Geschäftsführer des Konzerns Loschtschilin, Hauptingenieur Kurilo, der Leiter der Produktionsabteilung Jerschow, der Chef der Planungsabteilung Wolkow, der Leiter der Kaderabteilung Knjasew, der Direktor der Umladestation Sabrodin, der Chef der Funkstation des Konzerns Konstantinow und andere befanden (das hölzerne, zweigeschossige Konzern-Gebäude in Dudinka ist bis heute erhaltengeblieben). Innerhalb des Konzernsystems wurden in jenem Jahr kleinere Fisch verarbeitende Fabriken eingerichtet, und zwar die dudinsker, oschmarinsker, tolstonosowsker, chantajsker, leskinsker und wolotschansker Fabriken; außerdem vergrößerte man die Konservenfabrik in Ust-Port. Sie waren alle für die Annahme der gefangenen Fische gerüstet und nahmen dort auch deren Erstverarbeitung vor. Die gesamte Konzernstruktur basierte auf der Arbeitskraft der Sondersiedler. Auf diese Weise entstand in den Jahren 1942-1943 im Tajmyr-Gebiet ein neuer Industriezweig – und die jährliche Fischausbeute des Trusts betrug damals durchschnittlich 65000 Zentner. Wie sich allerdings im Jahre 1946 herausstellte, waren die Fischvorkommen in den Tajmyrer Staubecken und am Unterlauf des Jenisej dermaßen gering und vermehrten sich auch so langsam, dass sich die geschaffene Fischbranche mit dem Konzern an der Spitze als unrentabel erwies. Die Urheber der Anordnung des Rates der Volkskommissare der UdSSR hätten bereits Anfang 1942 wissen müssen, dass sich die Entwicklung und Widerherstellung der Fischvorkommen bei einem intensiven Fischfang unter den Bedingungen des Hohen Nordens, im kalten Wasser, merklich langsamer vollzieht, als in den warmen Gewässern des Kaspischen Meers oder der Wolga. Mit den Jahren erhöhte sich die Fangquote des Konzerns nicht, im Gegenteil – sie verringerte sich sogar. Das erste Signal für den Fehler, den man hier zugelassen hatte, war die Liquidierung des „Staatlichen Tajmyrer Fischkonzerns“ im Jahre 1946 mitsamt seinen Fischfabriken. Den zweiten Hinweis in diese Richtung gab die von den Kommandanten der Sonderkommandantur durchgeführte Massenanwerbung von Sondersiedler zum gewerblichen Fischfang in den Norden der Insel Sachalin. Zeugenberichten zufolge fuhren damals ungefähr 250 Sondersiedler über Krasnojarsk, Wladiwostok und weiter in den Norden Sachalins ab. Somit hatten also die Herren an der Spitze den Tatbestand anerkannt, dass 1942 ganz ungerechtfertigt zahlreiche,überhaupt nicht benötigte Menschen ins Tajmyr-Gebiet gebracht worden waren.
Es ist kein Zufall, dass ich die Aktivitäten der „Staatlichen Tajmyrer Fischkonzerns“ so detailliert beschreibe; sie sind mir bekannt, da ich als Wirtschaftler in der Planungsabteilung dieses Trusts tätig war und alle Statistiken übermeinen Tisch gingen. Eine Analyse und Bewertung der Ereignisse zwischen 1942 und 1948 im Tajmyr-Gebiet untersuchen wir später etwas genauer, aber kehren wir nun einstweilen nach Ust-Chantajka zurück.
Im Sommer 1942, zu Beginn unserer ersten Überwinterung, traf auf Anweisung des Vorsitzenden der Fischfang-Kooperative in Potapowo Bader eine neue Ladenverkäuferin bei uns ein, die sich zuvor als Leiterin der Kantine inPotapowo von ihrer besten Seite gezeigt hatte – Minna Alexandrowna Walter. Endlich stand hinter unserem Ladentisch eine aufrichtige, wohlwollende Frau, die schon ein wenig früher den ganzen Schrecken menschlichen Daseins in einem Rentierstall und in einer Erdhütte in Potapowo durchgemacht hatte. Selber Sondersiedlerin, hatte sie sich bei der Leitung der Fischfabrik ein gehöriges Maß an Vertrauen durch ihr selbständiges Arbeiten an einer einzeln stehenden Fischverkaufsstelle erworben. Ein derartiger Posten war zu der damaligen Zeit für einen Sondersiedler fast unerreichbar. Jedenfalls war dies im Bezirk Dudinka zum ersten Mal vorgekommen. Der Laden wurde nicht nur zu einer Handelsstelle, sondern auch zu einem von der Bevölkerung anerkannten, allgemein-öffentlichen Kulturzentrum: man richtete eine Bibliothek ein, und fing an, mittels vorbeifahrender Fahrzeuge, Zeitungen und Zeitschriften aus Dudinka anzuliefern. M.A. Walter unternahm rege Besuche in den Baracken, um den Menschen dort, die sich in einer elenden Lage befanden, alle nur mögliche Hilfe zu erweisen. Durch ihre Arbeit in Ust-Chantajka wurde M.A. Walter von ihrer Familie getrennt: Soh Harald (geb. 1927) konnte bei ihr bleiben, aber Tochter Viktoria (geb. 1925) wurde von der Sonderkommandantur zuerst in eine Fischfangbrigade am Jenisej, nach Priluki (50 km entfernt), geschickt und anschließend in die Brigade einer anderen Kolchose namens „Sapoljarnik“ (jenseits des Polarkreises Lebender; Anm.d. Übers.), die am Sigowoje-See (Maränen-See; Anm. d. Übers.) gelegen war. Mit Mutter und Bruder begann Viktoria erst später zusammenzuleben – im Herbst 1943. Unter vielen Menschen jener Zeit hat die Familie Walter im Hohen Norden gute Erinnerungen an sich hinterlassen.
Mit Herannahen des Frühlings 1943 nahm das Massensterben in Ust-Chantajka zu; ständig war die Bestattungsbrigade im Einsatz, welche die Toten aus Mangel an Holzbrettern nur „vorübergehend“ in einen Sarg legten und ihn dann mit Schlitten an einen Ort hinter der Siedlung abtransportierten, wo sie den Verstorbenen herausnahmen und im Schnee verscharrten. Eine exakte Statistik über die Umgekommenen gibt es nicht, es ist jedoch bekannt, dass allein zwischen März und Mai mehr als zweihundert Menschen aller Altersgruppen und Nationalitäten ihr Leben ließen. Gerüchte darüber drangen bis zum Bezirksgesundheitsamt vor. Aus Dudinka traf eine „Kommission“ von Ärzten und Vertretern der Sonderkommandantur ein. Es fand ein Rundgang durch alle Behausungen sowie die medizinische Betreuungsstelle statt. Eine Versammlung mit der Bevölkerung führte die Kommission nicht durch, sondern fuhr, nachdem sie unsere Ärztin N.W. Jankowitsch mitgenommen und damit unsere Siedlung ohne ärztliche Betreuung zurückgelassen hatte, zurück nach Dudinka. Dort wurde die Ärztin verhört; es wurden jedoch keine ernsthaften Anklagen gegen sie erhoben, aber man verlegte sie zum Arbeiten in die Siedlung Sitkowo und anschließend in die Poliklinik Dudinka. Neue medizinische Betreuerin in Ust-Chantajka wurde Olga Grischtschenko, die sogleich das Haus der „Bootsmänner“ belegte, in dem sie ein Sprechzimmer und einen stationären Behandlungsraum einrichtete.
Im Mai, amVorabend des einsetzenden Eisgangs, wird im Norden die Jagdsaison auf Gänse und Enten eröffnet, die dem fortschwimmenden Eis folgen, um zu ihren Vogel-Basaren zu gelangen. Die Mirgunows und Tschirkows schossen in dieser Saison jeder 150 Gänse ab, die sie nach Potapowo brachten, um sie dort einsalzen und in Fässern lagern zu lassen Der Eisgang verlief für die „Bootsleute“ gut; so wie es auch geplant gewesen war gelangte das Boot mit laufendem Motor ins Flüßchen und nahm, nachdem es das Ende des Eisgangs abgewartet hatte, Kurs auf Igarka. Viele aus der Siedlung waren gekommen, um die guten Menschen noch ein Stück zu begleiten, die sich gegenseitig Hilfe erwiesen hatten. Unser Schleppnetzboot mit den vier Rudern stand im Flüßchen unter der Last von Schleppnetz, Zelten, des Bettzeug, Geschirr und kleineren Netzen; die gesamte Brigade ließ sich im Boot nieder, während ich mich zum Heck, ans Steuerrad, begab, und nachdem wir das Flüßchen langsam verlassen hatten, lenkte ich es in die Nähe eines Eisberg, der sich während des Eisgangs dort gebildet hatte. Man konnte sehen, wie ganze riesige, dicke Eisplatten sich gegeneinander aufgetürmt und einen drohend über dem Wasser hängenden Eisberg geformt hatten. An einem so sonnigen, warmen Frühlingstag ist es sehr angenehm, ein wenig in der Nähe seiner Kühle ausstrahlenden Frische zu schwimmen. Die Mädchen kreischten vor vergnügen, als wir, wie im Märchen, unter dem Überhang hindurchfuhren. Und als wir uns von ihm gerade ungefär 100 m weit entfernt hatten, vernahmen wir hinter uns ein Krachen und das laute Platschen von ins Wasser stürzendem Eis; unser Boot wurde von einer Welle erfaßt und emporgeschleudert und durchnäßte mich, der ich am Heck saß, mit Spritzern des herabgefallenen Eisbergs. Mein Gott, wäre das nur wenige Minuten zuvor passiert, dann wäre die gesamte Petri-Brigade von dieser herabstürzenden Eismasse erschlagen worden, schließlich waren wir doch unmittelbar unter ihr hindurchgefahren! Wir waren also rein zufällig am Leben geblieben. Das war uns wieder einmal eine Lehre ob unserer Tollkühnheit gewesen. An diesem Verhalten war ich ganz allein schuld, denn ich hatte ja am Steuerrad gesessen. Gott hatte uns gerettet, indem er den Eisberg erst ein paar Minuten später hatte abbrechen lassen. Das war in meinem Leben das dritte Mal, wo mein Tod eigentlich schon mit 100%iger Wahrscheinlichkeit feststand.
Am Fangplatz errichteten wir fast den ganzen Tag über unsere Zelte, dichteten sie ab, stellten Pritschen auf, und gegen Abend besuchte uns der stellvertretende Direktor der motorisierten Fischfangstation – Konstantin Wasiljewitsch Migrunow. Stets hegte er eine besonders warme, freundliche Beziehung gegenüber unserer Brigade. Da der Polartag noch nicht zu Ende und es bis zum Abend noch recht lange hin war, beschloß K.W. Migrunow uns sein altes Geheimnis zu zeigen – wo man im Michajlowsker Flüßchen am besten die Netze für große Fische auslegen konnte. In einem kleinen Boot schwammen wir das Michajlowsker Flüßchen flußabwärts, wo sich auch ein Fischerhäuschen befindet. Neben anderen Brigaden war unsere die einzige, die außer dem großen Schleppnetz auch noch andere Netze auslegte. Wir handelten nach dem uralten Gebot: „Nicht der Fisch sucht den Fischer, sondern der Fischer den Fisch“. Einige Netze, die wir im Schachbrettformat ausgelegt hatten, versperrten das Flüßchen Michajlowska querdurch. K.W. Migrunow versprach uns für den morgigen Tag einen guten Fang. Bei unserer Rückkehr hatten die Mädchen wegen des Gastes schon sibirische Weißlachse gebraten, die sie gefangen hatten, indem sie bei Hochwasser das kurze Ende des großen Schleppnetzes (etwa 100 m) ausgelegt hatten. K.W. Mirgunow blieb an unserem Fangplatz auch noch zum Übernachten, und zum Mittagessen fuhren wir, nachdem wir den Fangplatz zuvor von havarierten Baumresten und Steinen gesäubert hatten, die beim Eisgang mit angeschwemmt worden waren, auf dem Michajlowsker Flüßchen entlang, um unsere Netze zu kontrollieren. Wie groß war unsere Verwunderung, als nach und nach riesige Fische aller Arten in unser Boot flogen: Störe, sibirische Weißlachse, Tajmen-Lachse und sogar eine ganze Reihe von Sterlingen. Die Fische hatten sich nach dem Winterschlaf auf das Futter am Ufer gestürzt, und deswegen konnte man jetzt, während des noch herrschenden Hochwassers, reichliche Fangausbeuten erzielen. Die Störe waren voller Rogen, und ich, als Astrachaner, machte mich sogleich daran, ihn zuzubereiten. Beim Mittagessen dankten wir Konstantin Wasiljewitsch alle ganz herzlich für sein „Geheimnis“ und gaben ihm als Geschenk einen Sterling mit, der zum frischen, Verzehr in rohem Zustand gedacht war. So nahmen wir uns, unter dem Schutz der „Leitung“, aus dem Fond „Mehr Fisch für die Front“, so lange wir an der Fangstation nicht unter Hauptmann Stepanows Kommandanten-Kontrolle standen. Sujew war erstaunt, als wir als erste gleich mehrere Zentner Fisch wertvollen Fischs auf einmal ablieferten. Selbstverständlich bewahrten wir über das Michajlowsker Geheimnis strengstes Stillschweigen.
Um seinen Service noch zu verbessern, baute und eröffnete der Vorsitzende der Fischkooperative Bader an unserer Fangstation einen Verkaufsstand zur Bedienung der Fischer, an dem man gegen Rulons nur die grundlegendsten Lebensmittel eintauschen konnte: Brot, Butter, Zucker, Graupen u.ä. Dieser Kiosk war aus Brettern zusammengehauen und befand sich an der Stelle, wo zuvor noch das Frühlingshochwasser gestanden hatte; er hatte somit eine Lebesdauer von nur einer Saison. Sujew beschloß, ebenfalls zu unserer Fangstation umzusiedeln; er organisierte seine Fischannahmestelle am Ufer, überdachte sie mit einem Zelt und grub sich eine Erdhütte für zwei Personen in den steilen Uferüberhang. Für uns war diese Nachbarschaft nicht wünschenswert, denn nun wurde es laut und belebt, aber natürlich war es auch angenehm bequem, dass wir die Fische gleich nebenan abliefern konnten. Minnotschka wurde von Bader zur Verkäuferin in dem Kiosk ernannt. Unsere Netze waren Tag und Nacht erfolgreich im Einsatz – jedesmal, wenn man sie kontrollierte, befand sich eine stattliche Anzahl großer Fische darin. Das war ein merklicher Zuwachs zu der Ausbeute, die mit dem großen Schleppnetz gemacht wurde. Als wir die Erstverarbeitung der von uns Fischern an der Annahmestelle abgegeben Fischen beobachteten, stellten wir fest, wieviele eßbare Innereien dort einfach fortgeworfen oder von den Möwen gefressen wurden, während die Menschen in der Siedlung am anderen Ufer weiterhin hungerten und starben; die Administration unternahm nicht einmal den Versuch, diesen Leuten mit Nahrungsmitteln zu helfen. Körbeweise wurden durchaus eßbare Kleinteile einfach den Möwen als „Festmahl“ vorgeworfen. Bis heute kann ich den Kolchosvorstand der Kolchose „Nordweg“ weder verstehen, noch ihr verzeihen, dass sie sich gegenüber ihren Kolchosmitgliedern so unmenschlich verhalten hat. In anderen Kolchosen hatten die Vorsitzenden Verantwortung auf sich genommen, indem sie, sogar im Kampf gegen die Sonderkommandantur, dafür gesorgt hatten, dass eßbare Fischabfälle an die Hungernden kamen, um sie so vor dem Tod zu bewahren. In Ust-Chantajka war das nicht der Fall; im Sommer und Winter des Jahres 1943 starben die Menschen weiter, obgleich die Siedlung von einer medizinischen Kommission untersucht worden war.
Natürlich ging das Leben weiter, die Fischindustrie war in vollem Betrieb. Nach dem Zufrieren der Flüsse im Oktober 1943 schickte der Kolchosvorstand mich, Wladimir Wolf, Ella Gaun und Amalie Müller zum Eisfischen – 7 km von unserem Fangplatz entfernt, und als Behausung gab man uns Sujews Erdhütte mit zwei Pritschen für jeweils zwei Personen, einem eisernen Ofen und einer Kerosin-Linienlampe als Beleuchtung. Sie stellten zehn Fischernetze auf, aber die Fangausbeute war ziemlich gering, so dass ich Sujew nur eine geringe Menge abliefern konnte.