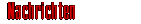

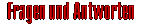



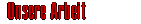




Aufgrund des Ukas des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR vom 28.
August 1941 wurde unsere Familie aus dem Dorf Morgentau, Bezirk Gmelin, Gebiet
Saratow, ausgesiedelt:
Mama Schwindt (geb. 1904), Brüder und Schwestern: Alexandra (geb. 1923), Viktor
(geb. 1925), Olga (geb. 1927), Valerija (geb. 1932), Robert (geb. 1934) und Erna
(geb. 1936). Wir waren eine der letzten Familien, die die Heimat verlassen
mußten, denn der neue Kolchosvorsitzende hatte Mama und Olga gebeten, die Kühe
zuvor noch einmal zu melken. Man muß sich einmal vorstellen, wieviel Vieh sie
zurücklassen mußten! Es war einfach schrecklich – die Kühe waren nicht gemolken,
sie liefen herum und brüllten jämmerlich; Bullen, Kamele, Schafe, Ziegen,
Schweine – sie alle wurden nun mit einem Schlag herrenlos. Das Vieh lief auf die
Felder, wo auf den Tennen das bereits gedroschene Getreide lag; damit fraßen sie
sich voll, und viele Tiere erlitten anschließend einen qualvollen Tod. Die
Alteingesessen sagten, dass es in diesem Jahr ein nie dagewesene, reiche Ernte
gegeben hätte, und all das war nun dem Verderb ausgeliefert. Denn es war ein
Staatssverbrechen, ausgerechnet zu Kriegszeiten, ein strategisch so wertvolles
Produkt umkommen zu lassen. Man transoprtierte uns zur Bahnstation und verlud
uns auf Güterwaggons, in denen man üblicherweise Vieh beförderte, mit
zusammengenagelten Doppelstock-Pritschen aus verstärkten Brettern. Es gab keine
Toilette, kein Waschbecken. Die Leute waren ohne Lebensmittel und ohne Geld
ihrem Schicksal überlassen. Die Fahrt nach Sibirien dauerte sehr lange; wenn wir
an den Bahnhöfen anhielten, bekamen wir Verpflegung zugeteilt. Während dieser
sich endlos hinziehenden Fahrt wurden Kinder geboren, Menschen starben.
Schließlich lieferten sie uns in Sibirien im Nasarowsker Bezirk, Region
Krasnojarsk, ab, wo am Bahnhof Fuhrwerke auf uns warteten, die uns in die
verschiedenen Dörfer brachten.
Wir gerieten nach Ust-Beresowka, anschließend nach Kolzowo, wo Alexander, Viktor und Olga in der Butterfabrik arbeiteten. Im September 1942 wurden wir zum zweiten Mal repressiert und aus Sibirien in den Hohen Norden verschleppt. Zuerst lieferten sie uns in Jenisejsk ab, wo sie uns in der Nähe einer Haftanstalt unter freiem Himmel absetzten. Am nächsten Tag führten sie uns alle, Erwachsene wie Kinder, ins Badehaus. Alle mußten sich splitternackt ausziehen; dann nahmen sie uns die gesamte Kleidung fort und brachten sie zur Läusevernichtung. (Für unsere Mama war das ein ganz schlimmes Erlebnis, denn in unserer Familie hatten sich die Eltern noch nie vor den Augen ihrer Kinder gewaschen). Danach wurden wir auf das Motorschiff „J.Stalin“ verladen und den Jenisej weiter flußabwärts geschickt. An den Dampfer war ein Leichter angehängt, dessen gesamtes Deck, und auch der Frachtraum, mit Deutschen voll beladen war. Bei der Ankunft in Igarka stellte sich heraus, dass die Besatzung des Dampfers betrunken war, und als sie von der Anlegestelle ablegten, stieß der Leichter gegen den Rumpf des Motorschiffs. Unsere Liegeplätze befanden sich ausgerechnet an Deck, so dass wir durch den heftigen Stoß in die Höhe flogen. Wir hatten Glück, dass es im Frachtraum nicht zu einem Leck gekommen war, sonst wären wir wohl alle untergegangen. Duch den Zusammenprall des Leichters mit dem Schiff war ein großes Loch entstanden, welches man mit einer Zeltplane abdeckte; und unsere Reise setzten wir trotzdm fort. Unsere Abladestelle befand sich 4 km unterhalb von Dudinka, in der Siedlung Pschenitschnij Rutschej, dem Standort der Fischfabrik von Dudinka. Hier lebten Deutsche, die schon vor uns hierher gebracht worden waren und die bereits einer Arbeit nachgingen. Man setzte uns buchstäblich wie Hunde am kahlen Ufer aus, das ganz mit Schnee bedeckt war, und dann krochen wir alle wie Würmer zu der noch im Bau befindlichen Fischfabrik hinüber. Alle waren hungrig; damals brachten uns die Frauen von der Fischfabrik (Deutsche) Fischinnereien, die wir anschließend über offenem Feuer garten.
Einige Tage später verlud man uns auf einen Kutter und verteilte uns auf verschiedene Siedlungen: nach Ust-Port, mit anschließender Verschickung ins Becken des Chatanga-Flusses, nach Ananewsk;und wir gerieten mit insgesamt 95 Personen nach Malyschowka, wo für uns die wahre Hölle begann. Man brachte uns in einerBaracke unter, in der es weder Fenster noch Türen gab. Die Baracke war aus grobem Holz gebaut, die Wände waren nicht verputzt. Sie war einfach wie ein Schuppen zusammengehauen und danach mit Grassoden ausgestopft worden. Eine Decke gab es nicht, auch keinen Fußboden – der bestand einfach aus Erdreich. Anstelle von Fenstern hatte man Öffnungen gelassen, wie es in Kuhställen üblich ist. Die Menschen gingen los, um Holzbretter zu suchen, damit sie die Löcher zunageln konnten; sie fertigten Türen an, die sie anstelle von Angeln mit irgendwelchen, mehrfach zusammengelegten Tuchfetzen versahen. Beleuchtung und einen Ofen gab es selbstverständlich auch nicht. Allerdings fanden sich zwei große Eisenfässer; die wurden an beiden Ende der Baracke als Öfen aufgestellt. Auf den Pritschen, die über die gesamte Länge der Baracke verliefen, wurden jedem Bewohner gerade einmal 50 cm Platz zuteil. Um ein wenig Licht zu haben, nahm man Holzfackeln, die zuvor angefertigt und dann an der Decke zum Trocknen aufgehängt worden waren. Durch die glühenden Fackeln entstand eine Menge Qualm und Ruß. Die Luft in der Baracke war dadurch derart verräuchert, dass der Speichel, wenn man am Morgen an die frische Luft trat und in den Schnee spuckte, einen schwarzen Rußfleck hinterließ. Später fingen sie an, Funzeln mit Fischtran zu verwenden. Die Lebensbedingungen in der Baracke waren so schlimm, dass wir uns nicht einmal so kleine Bequemlichkeiten, wie das nächtliche Ablegen der Oberbekleidung, erlauben konnten – wir schliefen in den Sachen, die wir schon den ganzen Tagt am Leib getragen hatten, denn es herrschte große Kälte. Das Schrecklichste in dieser Situation war, dass sich durch das enge Beieinanderliegen der Menschen auf den Pritschen eine Läuseplage entwickelte – das war wirklich grauenvoll, und außerdem erkrankten immer mehr Leute an Skorbut. Dieses Elend ging so weit, bis man am Morgen erwachte und neben sich eine Leiche vorfand. Ganze Familien starben aus, man schaffte es nicht, sie rechtzeitig zu bestatten, von Grabstätten konnte schon gar keine Rede sein – die Leichen wurden einfach bis zum nächsten Frühjahr im Schnee verscharrt. Unsere Familie blieb am Leben – dank der Tatsache, dass Mama es verstanden hatte, verschiedene Dinge, u.a. auch ihre Nähmaschine, mit hierher zu bringen; nun nähte sie auf Bestellung, die Aufträge erhielt sie von den Arbeitern der geologischen Expedition und hier in der Verbannung lebenden Letten, für die sie auch noch die Wäsche wusch. Die Männer von der Expedition kamen und kauften etwas von Mamas Sachen. Da es an Geld fehlte, gab Mama ihnen unsere Lebensmittelkarten, die sie aufkauften. Zwei Drittel der Lebensmittel behielten sie hinterher für sich, und ein Drittel bekam Mama. Wir waren ihnen sehr dankbar, denn wir besaßen überhaupt kein Geld für den Bezug von Nahrungsmitteln. Wir Kinder durchstöberten die Abfallhaufen, aus denen wir Fischgräten heraussammelten; später brieten wir sie auf dem Ofen und aßen sie. Deswegen leiden wir jetzt wohl auch unter Magenschmerzen. Im ersten Winter (1942-1943) starben von den ursprünglich 95 Personen, die in der Baracke überwinterten, 37, das waren 40%. In den nachfolgenden Jahren setzte sich die Sterblichkeitsrate auf dem gleichen Niveau fort. Ein Jahr später bauten wir uns eine „Chalupa“ (kleine Hütte; Anm. d. Übers.), aber darin war es immer noch besser, als in der Höllenbaracke.
Alles, was weiter oben gesagt wurde, bezieht sich auf das Jenisejsker Becken des Tajmyr-Gebiets – von Ust-Chantajka bis zur Insel Dickson. Allerdins wurden Sondersiedler auch zur „Urbarmachung“ des Chatanga-Beckens abtransportiert, das sich am Ostrand der Halbinsel Tajmyr befindet. Die Menchen, die in den Bezirk Chatanga gerieten, mußten noch viel mehr durchmachen, als die „Jenisejer“. Große Dankbarkeit gilt einem der „Chatangaer“, Karl Kühl, der uns bis heute all das Grauen, das er durchmachen mußte, vermittelt hat.