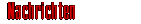

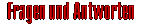



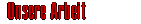




„Glücklich ist der, der den Beginn des Lebens mit seinem Ende
vereinen kann“.
J.W. Goethe
Der Ukas über unsere Umsiedlung wurde im August 1941 verabschiedet, und so wurden wir sechs Kinder zusammen mit unserer Mama (Papa war bereits 1938 verhaftet worden) als eine der letzten Familien im September fortgebracht, denn der neue Kolchos-Vorsitzende hatte Mama und meine Schwester Olga gebeten, vor unserer Abfahrt noch einmal die Kühe zu melken. Es war ganz schrecklich – das ganze Vieh mußte wegen dieses Ukas ohne Fürsorge zurückgelassen werden; vor allem die ungemolkenen Kühe liefen rastlos umher und brüllten. Ochsen, Kamele, Schafe, Ziegen, Schweine – all diese häuslichen Lebewesen sollte man nun einfach so im Stich lassen. Besonders traurig war der Umstand, daß diese ganzen Lebewesen sich auf die Felder begaben, um sich dort mit Getreide vollzufressen – viele von ihnen starben. In dem Jahr war eine so gute Ernte eingebracht worden, wie es noch nie zuvor der Fall gewesen war. Alles war bereits gemahlen worden und lag nun auf den Tennen, so daß die Körner für das Vieh sehr leicht zugänglich waren. Später kam uns zu Ohren, daß das gesamte Getreide – und mit ihm das Vieh, dem Verderben anheim fiel. Haben die Behörden da nicht an ihrem eigenen Volk, in einer Zeit in der Krieg und Hunger herrschten, schändlichen Verrat und ein Staatsverbrechen begangen? Schließlich war es doch so, daß die allgemeine Lage im Lande ständig einen gewissen Vorrat an Lebensmitteln erforderte. Aber die Belange und Bedürfnisse der Bevölkerung wurden von der Staatsmacht nicht berücksichtigt, während die Mächtigen selbst vollkommen abgesichert und ausreichend versorgt waren!
Man brachte uns zur Bahnstation, wo man uns in Viehwaggons einsteigen ließ, in denen zweistöckige Pritschen standen – es gab weder Toiletten noch Waschbecken. Da die Abfahrt in aller Eile erfolgt war, hatte niemand Geld oder Lebensmittel mitnehmen können. Unser Transport dauerte lange und führte kreuz und quer über alle möglichen Umwege. Zu essen gaben sie uns wäahrend der Zughalte an den Bahnhöfen. Während der Fahrt wurden direkt in den Waggons Kinder geboren, manche Menschen starben. Als wir in Sibirien abgeliefert wurden, erwarteten uns dort an der Bahnstation bereits Fuhrwerke, mit denen wir anschließend auf die einzelnen Dörfer verteilt wurden. Unsere Familie kam nach Ust-Berjosowka in der Region Krasnojarsk, wo wir allerdings nicht lange lebten; wir mußten nach Kolzowo umziehen, denn Alexander, Viktor und Olja fanden dort Arbeit in der Butterfabrik.
Im September 1942 wurden wir erneut deportiert: man verschickte uns in den Hohen Norden – ins Tajmyr-Gebiet. Zuerst lieferten sie uns in Jenisejsk ab, wo wir die Nacht unter freien Himmel, in unmittelbarer Nähe eines Gefängnisses verbringen mußten. Am nächsten Tag wurden alle Erwachsenen und Kinder unter Wachbegleitung ins Badehaus getrieben. Nachdem sich alle splitternackt ausgezogen hatten, wurde uns die gesamte Kleidung weggenommen und zur Desinfektion gebracht (für unsere Eltern war das ganz schrecklich, denn sie hatten sich noch nie zusammen mit ihren Kindern gewaschern; das war bei uns nicht üblich). Anschließend wurden wir auf den Dampfer „J. Stalin“ verladen und schwammen den Jenisej flußabwärts. Unser Dampfer fuhr im Schlepptau - voll beladen, denn überall im Frachtraum und an Deck befanden sich unserer Deutschen. Als wir in Igarka eingetroffen waren, veranstaltete die Besatzung unseres Dampfers ein umfangreiches Trinkgelage, mit dem Ergebnis, daß der Dampfer beim Ablegen von der Anlegestelle mit einem Leichter zusammenstieß. Zu der Zeit lagen wir an Deck, genau an der Stelle, an der der Zusammenprall erfolgte. Wir wurden alle durch den heftigen Stoß in die Luft geworfen. Unser einziges Glück bestand darin, daß im Frachtraum kein Leck entstanden war, sonst wären wir wohl alle untergegangen. Trotzdem war eine großes Loch im Schiffsrumpf entstanden, welches sich allerdings oberhalb der Wasseroberfläche befand; es wurde mit einer Zeltplane abgedeckt, und wir konnten weiterfahren.
Den Anker warf unser Dampfer dann auf Höhe der Fischfabrik in Dudinka; dort befanden sich bereits Deutsche, die vor uns hierher verschleppt worden waren, und schon einige Zeit in der Fischverarbeitung tätig gewesen waren. Wir wurden wie Hunde einfach am Ufer ausgesetzt, das schon ganz verschneit war. Wie Würmer krochen wir in das noch im Bau befindliche Gebäude der Fischfabrik. Die Neuankömmlinge waren hungrig; da brachten uns die in der Fabrik arbeitenden Frauen (Deutsche) Fischdärme, aus denen wir am Laferfeuer eine Mahlzeit zubereiteten. Einige Tage später verteilte man uns mit Booten in die verschiedenen Siedlungen und auch „an den Rand der Welt“, an den Fluß Chatanga, der die Halbinsel Tajmyr im Osten umspült, nach Ust-Port und Ananewo; unsere Familie geriet nach Malyschowka.
Und genau hier begann die wahre Hölle. Wir, das waren insgesamt 95 Personen, wurden in einer Baracke ohne Fenster und Türen untergebracht, die aus lauter Holzabfällen gebaut war. Die Wände waren kalt; das ganze Gebäude war einfach wie ein Schuppen zusammengehauen und mit Grassoden verkleidet und ausgelegt worden. Eine Raumdecke gab es nicht. Der Boden bestand einfach aus Erde. Anstelle von Fenstern gab es Öffnungen, so wie man sie aus Kuhställen kennt. Die Menschen begaben sich unverzüglich ans Ufer, um Bretter zu suchen, mit denen sie die „Fenster“-Öffnungen vernageln konnten; irgendwie gelang es, aus irgendw3elchen Fetzen und Lumpen eine Art Türen anzufertigen. In der Baracke gab es weder Lampen noch Öfen. Es fanden sich zwei 200-Liter-Fässer, die zu beiden Enden der Unterkunft aufgestellt wurden. Auf den durchgegehenden Pritschen, die, der Länge nach, von einer Seite der Baracke bis zur anderen angeordnet waren, war für jeden ein Platz von einem halben Meter vorgesehen. Zur Beleuchtung wurden Späne verwendet, die wir zuvor beschafft und dann am Dach zum Trocknen aufgehängt hatten. Man soll sich nur einmal vorstellen, in was für einem Ruß und Qualm wir dort gelebt haben: wenn man aus der Baracke hinaustrat und ausspuckte, sah man im Schnee einen Rußfleck. Später wurden aus Fischtran Funzeln angefertigt. Nachts zogen die Menschen ihre Kleidung auf ihrem halben Meter „Schlafraum“ nicht aus, denn es war sehr kalt. Dafür entwickelten sich in der Enge dermaßen viele Flöhe, daß es einfach nur grauenvoll war – denn es gab keine Bademöglichkeit!
Bald darauf erkrankten die Menschen an Skorbut. Es kam vor, daß man am Morgen erwachte und direkt neben einem lag eine Leiche. Ganze Familien starben aus. Ohne Sarg konnte man die Toten nur im Schnee begraben, denn im ewigen Frostboden war es unmöglich Gräber auszuheben. Mama ist es zu verdanken, daß unsere Familie am Leben blieb, denn es war ihr gelungen, von zuhause alles Notwendige mitzunehmen, darunter auch eine Nähmaschine. Zu jener Zeit arbeitete in Mesojacha, am linken Ufer des Jenisej, eine wissenschaftliche Expedition, die dort für die Stadt Norilsk nach Erdgas suchen sollte. Einige ihrer Teilnehmer kamen zu uns und kauften Mama ein paar Sachen ab. Sie besaß zwar kein Geld besaß, aber um irgendwie an Lebensmittel heranzukommen, gab sie ihnen unserer Lebensmittelkarten, damit sie davon Eßwaren kauftern; zwei Drittel davon behielten sie für sich selbst, das restliche Drittel gaben sie Mama. Wir waren ihnen dafür sehr dankbar. Außerdem wusch und nähte Mama für die Expeditionsteilnehmer, aber trotzdem reichte das Essen für uns nicht; es kam so weit, daß wir Kinder aus dem Abfall Fischknochen heraussammelten, die wir dann auf dem Ofen brieten und aßen. Das ist der Grund, weshalb wir heute an Magenschmerzen leiden. Von den ursprünglich 95 eingetroffenen Personen verstarben 37 allein im ersten Winter.
Ein Jahr später bauten wir uns aus allem möglichen Gerümpel eine kleine Hütte. Das war eine viel bessere Behausung als die Baracke. Im Sommer kamen wir mit Hilfe der Expedition zu einem Ofen; wir besorgten uns Brennholz und sammelten wilden Lauch und Beeren – das Leben wurde ein wenig erträglicher. Es gab eine Unmenge Fisch, nur nehmen durften wir ihn uns nicht. Die Losung „Mehr Fisch für die Front“ gestattete es uns nicht. Für einen einzigen entwendeten Hering bekamst du eine Haftstrafe von einem Jahr aufgebrummt. Geld bekam man fast nirgends ausbezahlt. Ich erinnere mich noch daran, daß Mama, Viktor und Olga, alle drei zusammen, für einen Zeitraum von drei Monaten lediglich 19 Rubel erhielten. Es war bekannt, daß der Direktor und Buchhalter der Dudinsker Fischfabrik Geld für sich einbehielt. Es gab niemanden, bei dem man sich beschweren konnte, denn wir galten als „Faschisten“. So sagte unser Brigadeführer aus Astrachan es gerade heraus: „Man hat euch als Tiere hierher gebracht und uns als Jäger, deswegen werden wir mit euch machen, was wir wollen“. Ich habe nicht vergessen, wie wir zu den Vorgesetzten gingen und dort deutsche Lieder sangen und sie uns dafür jedem von uns ein Stückchen Brot gaben. Wir haben eine schreckliche Zeit durchgemacht, und es ist unmöglich, sie an einem einzigen Tag ausführlich zu beschreiben.
Valeria Schwindt, 18.02.2009