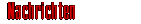

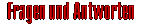



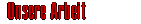




„Das Gesetz, das in uns lebt, ist das Gewissen“. Immanuel Kant
In der Nacht des 6. Februar 1938 wurde mein Vater verhaftet und zwei Wochen später auf Anordnung einer „Trojka“ erschossen. Mama blieb mit sechs Kindern zurück: ich, der Jüngste, war gerade ein Jahr und drei Monate alt, mein ältester Bruder Alexander 15. 1941 wurden wir aufgrund des bekannten Ukas vom 28. August politisch verfolgt und aus der ASSR der Wolgadeutschen in den Nasarowsker Bezirk, Region Krasnojarsk, Sibirien, abtransportiert. 1942 wurde mein älterster Bruder in eine NKWD-Arbeitskolonne mobilisiert; gleichzeitig wurde Mama mit den verbliebenen fünf Kindern zum zweiten Mal repressiert: im September desselben Jahres schickte man sie auf einem Dampfer den Jenisej flußabwärts, fast ganz bis an seine Mündung .... dem Winter entgegen. Wir wurden in der kleinen Siedlung „Malyschewka“, Bezirk Dudinka, Nationalkreis Tajmyr, ans Ufer gesetzt - etwa 100 km von Dudinka entfernt, insgesamt 80 Personen verschiedener Nationalitäten gehörten zu diesem Sonderkontingent, vorwiegend Kinder, Halbwüchsige, Frauen und alte Leute. Am Ufer stand nichts weiter als eine einzige Baracke, sonst nichts; es gab dort nicht einmal Ortsansässige oder irgendwelche „hohen Herren“, die uns hätten in Empfang nehmen können. Die 80 Neuankömmlinge fanden mit Müh und Not unter dem Dach der Baracke mit den zerbrochenen Fensterscheiben Platz. Sogleich sammelten sie trockenes Gras, um damit die Pritschen auszulegen. Ein einziger Ofen, hergestellt aus einem Eisenfaß, sollte die ganzen Bewohner aufwärmen. Später stellte sich heraus, dass diese Siedlung immer nur saisonweise für die mit der „Magistrale“ hier eintreffenden, gewerblichen Fischfang-Brigaden existierte.
Bald darauf schickte man die Halbwüchsigen, unter ihnen auch meinen Bruder Viktor (18) und meine Schwester Olga (16) ans andere Ufer des Jenisej, nach Funtusowskije Peski, zum Fischfang. Wir kamen dort an, nachdem die Hauptfischsaison bereits zuende gegangen war; wir sollten die im Jenisej im Eis fischen. Fast der gesamte Menschenbestand wurde der Fischfabrik Dudinka zugeteilt; die Fischkooperative organisierte ihre Versorgung mit Hilfe von Lebensmittelkarten. Eine klägliche Ration war das, und dann mußte sie auch noch ganz aus Dudinka (100 km) herangeschafft werden. Nur die Fischer hatten so gerade eben ihr Auskommen. Alle anderen hungerten, froren, waren ständig krank (es gab überhaupt keine medizinische Betreuung). Skorbut brach aus, und zum Winter gab es die ersten Toten; und weil den Menschen die Kraft ausgegangen war, mußten sie mit den Leichen in ihrer unmittelbaren Umgebung noch eine ganze Weile zusammenleben.
Die Bilanz des ersten Winters 1942-1943 sah folgendermaßen aus: von 80 Menschen waren 30 erfroren. Man muß dabei berücksichtigen, dass dies im wesentlichen Leute betraf, die durchaus in der Lage gewesen waren, produktive, körperliche Arbeit zu leisten, und nicht etwa gebrechliche Alte, aber ihr Allgemeinzustand war so weit heruntergekommen, dass sie schließlich zu den Todeskandidaten gezählt hatten. Man muß sich dabei ganz klar vor Augen führen, dass all diese Sondersiedler am Ufer eines riesigen Flusses lebten, an dem der gewerbliche Fang wunderbarer Fische betrieben wurde; aber niemand (außer den Fischern) besaß das Recht, für eine normale Existenz ohne Hunger, auch nur einen einzigen Fisch zu erhalten. Die Losung „Mehr Fisch für die Front“ gestattete es den Behörden, das Hungerregime unter den Sondersiedlern zu rechtfertigen, obwohl damals die gesamte Fischausbeute des Tajmyrgebiets in Wirklichkeit für die Versorgung des Häftlingssonderkontingents am Norilsker Bergbau- und Hütten-Kombinat sowie das örtliche Handelsnetz der Umgebung verwendet wurde.
Im Sommer 1943 und im Winter 1943-1944 setzte sich die hohe Sterblichkeit in Malyschewka fort. 1948 erlaubte die Sonderkommandantur Mama mit ihren drei Kindern nach Dudinka umzuziehen, um dort weiter zur Schule zu gehen und die 8. Klasse nachzuholen. Ich hatte kein Glück – ich erkrankte an heftigem Gelenkrheumatismus und verbrachte den ganzen Winter im Krankenhaus und zuhause. Zum Frühjahr 1952 war ich genesen und fand eine Arbeit als Buchhalter-Lehrling in Der Fischerei-Kooperative von Dudinka. 1954 schickten sie mich zur Ausbildung an die Schule der Turuchansker Handelskooperative, wo ich die Aufnahmeprüfungen bestand und zwei Monate bei der Heuernte tätig war, aber als der Direktor, der gegenüber den Deutschen einen großen Haß hegte, aus dem Urlaub zurückkehrte, schloß er mich vom weiteren Unterricht aus, indem er mir sagte, dass ich in die Schule nicht aufgenommen worden wäre. Unter Tränen kam ich nach Dudinka zurück und mußte dort als Buchhalter arbeiten. Zeitgleich befaßte ich mich, nach der Arbeit, von 1951 bis 1955, mit künstlerischer Laientätigkeit im Hafenklub. 1955 entsandte mich der Oberbuchhalter der Fischerei-Kooperative, Georgij Iwanowitsch Kugawa, in die Stadt Abakan auf die handelsgenossenschaftliche Schule. Dort begann ich Chorgesang zu studieren. Nach Abschluß dieser Schule (1956) kehrte ich nach Dudinka zurück, wurde dort befördert und Oberbuchhalterin der Handelsgruppe innerhalb der Fischereigenossenschaft. 1960 schrieb ich mich für den Fernunterricht am Statistischen Technikum in Moskau ein und wechselte zwei Jahre später ans genossenschaftliche Technikum Krasnojarsk, wo ich, ebenfalls im Fernstudium, das Fachgebiet Warenkunde belegte. 1963 erhielt ich das Diplom einer Handelsfachfrau für industriell hergestellte Nahrungsmittel. In der freien Zeit, die mir nach der Arbeit und dem Studium noch blieb, beschäftigte ich mich in der Sporthalle mit Volleyball und wurde Mitglied der Frauenmannschaft von Dudinka. Von 1963 bis 1966 versuchte ich mehrfach mich bei verschiedenen Moskauer Fremdsprachen-Instituten für das Unterrichtsfach „Dolmetscher“ einzuschreiben, erhielt jedoch nur Absagen. Da immatrikulierte ich schließlich am Nowosibirsker Institut für sowjetichen kooperativen Warenhandel im Rahmen eines Fernkursus, der 1971 endete. Ich erhielt das Diplom einer Buchhalterin und Wirtschaftsfachfrau. So lebte ich als 42 Jahre in Dudinka, von denen ich 20 Jahre im System der regionalem tajmyrer Fischerei-Konsumvereinigung auf verschiedenen Posten tätig war: als Buchhalterin, Stellvertreterin des Hauptbuchhalters für das Finanzwesen, Haupt-Ökonomin der planwirtschaftlichen Abteilung. Weitere 13 Jahre (von 1972 bis 1984) arbeitete ich in der Hafenverwaltung von Dudinka als Hauptwirtschafter der Planungsabteilung. Im September 1984 verließ ich meine Wohnung in Dudinka und zog in die Stadt Krasnojarsk um. Dort fand ich eine Stellung als Leiterin der Finanzabteilung der regionalen Fischerei- Konsumvereinigung. Hier blieb ich bis 1988, als ichmih bemühte, ein wenig näher bei meiner Tochter und den Enkelkindern zu wohnen, die in Riga lebten. So zog ich von Krasnojarsk zunächst nach Pskow und dann nach Jelgawa (30 km von Riga entfernt). Dank der Hilfe meiner Tochter und ihrer Kinder fand ich auch dort einen Arbeitsplatz – als Verkäuferin in einem Kiosk des Druckereiverbandes in Riga.
In der ehemaligen UdSSR führte ich eine recht aktive Lebensweise: ich betätigte mich im Sport, wirkte in künstlerischen Laiengruppen mit, eilte zu Prüfungsarbeiten, war geschäftlich unterwegs, besuchte Kurse zur Höherqualifizierung in Astrachan (1965), Odessa (1983), Moskau (1985) und Leningrad (1986); außerdem reiste ich nach Irkutsk. Während meiner Arbeitsjahre im Tajmyrgebiet war ich auch dort kreuz und quer unterwegs, in all seinen nördlichen Ecken sowie in Sibirien: in Dickson, Chatanga, Wolotschanka, Nikolsk, Potapowo, Ust-Chantajka, Igarka, Jenisejsk, Bogutschany und an anderen Orten. Neben den beruflichen Dingen interessierte mich vorort auch immer das Leben der Sondersiedler. Der allgemeine Eindruck dessen, was ich in den kleinen Siedlungen zu Gesicht bekommen hatte, waren die Armut, in der die Menschen dort lebten, die jämmerlichen Lebensbedingungen und der Hunger; all das blieb mir in der Erinnerung, als in den 1940er Jahren die meisten Frauen, Kinder und alten Leute starben: in Agapitowo waren es 500, in Ust-Chantajka 270, in Potapowo 1100 usw.; ein trauriges Bild im gesamten Bezirk Chantajka. Verschont blieben lediglich diejenigen, die in irgendeiner Form mit dem Fischfang zu tun hatten oder über einen dauerhaften Arbeitsplatz verfügten.
Im Dezember 1994 zog ich mit meiner Tochter und den beiden Enkeln nach Deutschland um, was mein Leben veränderte. Es begannen Laufereien zu verschiedenen „Ämtern“, es gab materiellen Mangel, die Sehnsucht nach Freunden und guten Bekannten, die in der Sowjetunion zurückgeblieben waren. 1996 nahm ich in Stuttgart an einem „Treffen“ Deutscher aus Rußland teil, das unsere Landsmannschaft organisiert hatte. Dort hörte ich zum ersten Mal den rußlanddeutschen Chor „Heimatklänge“ unter der Leitung von Marina Bauer. Sein Auftritt gefiel mir sehr. Ich suchte in Stuttgart das „Haus der Heimat“ auf und meldete mich zum Mitsingen in diesem Chor an. Im Juli 1997 erhielten wir von Professor Müller aus Amerika (Nord-Dakota) eine Einladung: wir sollten dorthin kommen und vor den Nachfahren Rußlanddeutscher singen, deren Vorfahren einst in der Hauptsache am Schwarzen Meer, in der Ukraine, gelebt hatten. Wir nahmen diese Einladung an und resiten im Juli 1997 zwei Wochen lang mit dem Autobus durch die Staaten Nord- und Süd-Dakota, traten in Kirchen, Sportarenen und Klubs auf. Es gab Begegnungen mit ortsansässigen Deutschen, die fast alle nur Englisch sprachen, mit Ausnahme einiger weniger, die (mit großer Mühe) noch ein wenig Deutsch konnten. Ich traf mehrere Personen mit dem Familiennamen Schwindt, allerdings gelang es nicht, irgendwelche verwandtschaftlichen Beziehungen herzustellen, denn aus der älteren Generation war schon nicemand mehr am Leben und von den jüngeren Leuten wußte kaum jemand etwas über seine Vorfahren.
Im Oktober 2003 organisierte das Reisebüro „Schwaben International“ zu Ehren des 125-jährigen Jubiläums der Ankunft der Wolgadeutschen in Argentinien eine Reise, und unser Chor hatte die Gelegenheit, dieses Land zu besuchen. Viele aus dem Chor konnten sich nicht sofort zu dieser Reise entschließen, denn sie war mit finanziellen Problemen verbunden. Aber schließlich fanden sich, nach langen Überlegungen und Verhandlungen, 15 Chormitglieder, 4 Verwandte und 4 ortsansässige Deutsche, die daran teilnehmen wollten. Am 23. Oktober 2003 flogen wir von Frankfurt am Main, mit Zwischenlandung in Sao Paulo (Brasilien), in die argentinische Hauptstadt Buenos Aires, wo wir am Flughafen vom Präsidenten des argentinischen „Schwaben International“, Herrn Juan M. Heit, sowie der Präsidentin der Organisation der Wolgadeutschen in Argentinien, Isabelle Kessler, in aller Herzlichkeit empfangen wurden. Herr Heit, selber Abkömmling einer wolgadeutschen Familie, erzählte uns ein wenig über die Geschichte der Wolgadeutschen in Argentinien; er begann mit ihrer Ansiedlung im Jahre 1878 und endete mit der Gegenwart. Er teilte uns mit, dass in Argentinien mehr als zwei Millionen Nachfahren der Wolgadeutschen leben. Aus unserer Gruppe war zuvor noch keiner jemals in Argentinien gewesen; während der gesamten Reise befanden wir uns in einem Zustand der Anspannung, denn wir hatten keine Vorstellung davon, wie unsere „Landsleute“ uns begrüßen und aufnehmen würden. Nach kurzem Aufenthalt in Buenos Aires begaben wir uns mit dem Autobus auf eine 13-tägige Fahrt durch Argentinien. Begleitet wurden wir der Reihe nach von: M. Heit, Dr. Carlos Hartmann, Dr. Estelio Arturo Folmer, Jutta Nikel – Direktorin des deutschen Instituts in der Stadt Parana, M. Preduger und R. Giukits, I. Kessler, R. Buksmann, Jose und Liliana Kareis. In bestimmtem Abständen gesellten sich noch andere zu ihnen oder ersetzten sie: der Zahnarzt Ignaz Getti. Jose Danner und der katholische Pfarrer Begener. Unser Weg führte uns durch die Provinz Entre Ruos (durch die Stadt Parana und die wolgadeutschen Siedlungen Aldea Spatzenkutter, Protestante, Valle Maria, Aldea Brasilera, San-Francisco, Salto, Maria-Luisa, Krespo und Santa-Maria), Buenos Aires (San-Miguel, Chinojound Koronel-Suarez) sowie La Patra (Santa-Rosa).Am 25. Oktober, auf dem Weg Nach Parana, verliebten wir uns in die Natur und die endlosen Weiten Argentiniens. Vor der Stadt Parana fuhren wir durch einen Unterwasser-Tunnel, der unter dem Fluß Parana, in einer Länge von 3300 Metern verläuft; er ist 8 Meter breit und 800 Meter tief. Um drei Uhr nachmittags trafen wir in Parana ein; der Busfahrer begann auf die Hupe zu drücken und ließ sie nicht eher wieder los, als bis wir das „Haus der Wolgadeutschen“ erreicht hatten, wo die Leute aus ihren Häusern traten, um uns in Empfang zu nehmen. Vor dem „Haus“ hatte sich eine große Menschenmenge versammelt; man begrüßte uns mit Musik, Beifallklatschen und lächelnden Gesichtern. Dann sagte jemand: „Deutsche aus Deutschland sind zu uns zu Besuch gekommen!“ Es war sehr rührend, diese Freude zu sehen, mit der sich Menschen, denen das gleiche Schicksal widerfahren war, hier begegneten. Nach einer kurzen Begrüßung wurden wir in verschiedenen Wohnungen untergebracht. Gegen 20 Uhr brachte man uns in einen geschmückten Saal, in dem unser Chor auftreten sollte. Der ortsansässige Chor sang drei Lieder, danach zogen sich mehrere angenehme Stunden mit Bekanntschaftenschließen, Unterhaltungen und Tanz hin. Die Nachricht von unserem Besuch hatte sich schnell in ganz Argentinien verbreitet: per Radio und Fernsehen. Der Abend verlief in warmer, freundschaftlicher Atmosphäre, an gedeckten Tischen, mit gemeinsamem Gesang. Vom 26. bis 28. Oktober wohnten wir zu viert bei Sizilia und Oresto Bauer in Parana, von wo aus wir täglich Fahrten in die nahegelegenen wolgadeutschen Siedlungen unternahmen: Aldea Spatzenkutter, Protestante, Valle Maria, Aldea Brasilera, San Francisco, Salto, Maria Luisa, Krespo und Santa Maria. Am 26. Oktober, einem Sonntag, sangen wir in der Kirche von Valle Maria während des Gottesdienstes; anschließend waren wir zum Mittagessen eingeladen. Das bis auf den letzten Platz gefüllte Restaurant begrüßte uns mit Beifall; alle standen auf, als wir hereinkamen. Wir begaben uns auf die Bühne und sangen einige Lieder, danach setzten wir uns an die Tische und unterhielten uns mit den Nachfahren der Wolgadeutschen; später tanzten wir und lauschten auch ihren Musikensembles: vier Kinder im Alter von 11-13 Jahren, die hervorragend spielten, sowie einige Erwachsene, die ein paar Lieder sangen. Am 28. Oktober (meinem Geburtstag) fuhren wir nach Krespo, wo 80% der Bevölkerung Abkömmlinge von Wolgadeutschen sind. Schon bei der Einfahrt in die Stadt fielen einem die Sauberkeit und die Ordnung auf der Straße und um die Häuser ins Auge. Im Rathaus begrüßte uns Bürgermeister Schneider, ein Abkömmling von Deutschen aus Köln, aber er sprach ausschließlich Spanisch. Nach der Begrüßung im „Stadtrat“ ins Speiselokal „Zum Fritz“ zum Mittagessen ein. Hier sahen wir uns im Fernsehen – am Vorabend hatte unsere Dirigentin Marina Bauer ein Interview gegeben. Wir sangen ein paar Lieder, denen sich einige luustige und rührselige Lieder des ortsansässigen Ensembles, bestehend aus 5 wolgadeutschen Nachfahren (alles Männer) anschlossen, die von einem Akkordeon begleitet wurden. Ihr letztes Lied rührte mich zu Tränen, denn darin war von der Ungewißheit die Rede, welche die Menschen nach ihrer Abreise von der Wolga in Amerika erwartet hatte. Man gratulierte mir zum Geburtstag, und das Ensemble, das schon zuvor aufgetreten war, sang extra für mich noch einige Lieder, was ich als sehr schön empfand. Nach unserem Aufenthalt in Krespo machten wir uns auf den Weg nach Santa-Maria, wo sich vor der großen Kirche bereits eine Menschenmenge versammelt hatte und die Kirchenglocken zu unserer Begrüßung läuteten. Die Menschen lächelten freundlich. In der Kirche sang unser Chor einige Kirchenlieder, und es stellte sich heraus, dass dies der erste Chor war, der jemals in dieser Kirche gesungen hatte. Nach unserem Auftritt sprachen wir noch lange mit den Ortsbewohnern – den Abkömmlingen der Wolgadeutschen. Als wir Parana am 29. Oktober verließen, gestaltete sich der Abschied mit unseren Wohnungsgebern äußerst herzlich uns rührselig. Wir fuhren weiter in die Stadt Ramirez it seiner 10.000 Einwohner zählenden Bevölkerung, wo es mehrere Schulen und Kirchen gibt. In der Firma „Gross“, in der Anhänger für Lastkraftwagen hergestellt werden, war Arturo Müller der Chef, ein Nachfahre der Wolgadeutschen, der leider im Frühjahr 2003 verstorben war. Die Stadt hält die Verbindung mit Deutschland aufrecht. So wurde 1973 ein evangelisches Krankenhaus errichtet, für dessen Bau 75% der Finanzierungskosten aus Deutschland stammten – der Rest wurde von verschiedenen Organisationen zur Verfügung gestellt. Nach dem Mittagessen fuhren wir in die Stadt Lucas Conzalez, wo man uns erneut auf Privatwohnungen verteilte. Für den Abend war ein interessanter Gemeinschaftsabend mit Ortsansässigen organisiert worden, auf dem unser Chor auftrat und vom Fernsehen gefilmt wurde. Ich muß gestehen, dass uns das Fernsehen in alle Städte des Landes begleitete; das war für uns als Auftretende sehr angenehm. Zuhause in Deutschland interessiert sich kein Fernsehsender für uns, obgleich wir viele erfolgreiche Auftritte vorweisen können. Am 30. Oktober fuhren wir in die Stadt Gualeguaga, die sich 40 km vom Fluß Uruguay entfernt befindet; er bildet die Staatsgrenze zwischen Argentinien und Uruguay. Wir trafen nach dem Mittagessen dort ein und wurden sogleich wieder in Privatunterkünften untergebracht. Lena Esau und ich kamen zu einem Zahnarzt, dessen Frau Abkömmling der Wolgadeutschen ist; er selbst stammt aus Deutschland. Am Abend versammelten sich alle in einem großen Saal, in dem noch vor dem Abendessen unser Chor auftrat. Eigentlich hatten wir auf der Straße, unter freiem Himmel, singen sollen, aber dann brach der Abend herein, es begann zu regnen und ein Gewitter zog auf, so dass wir im Saal auftreten mußten. Der Abend verlief in guter, warmer und freundschaftlicher Atmosphäre. Der Geistliche Carlos Neubert war unser Dolmetscher. Hier überreichte uns Frau Riffel für die Landsmannschaft der Deutschen aus Rußland zwei Videofilm-Kopien der Feierlichkeiten zum 50. Jubiläum er Emigration der Wolgadeutschen nach Argentinien. Am 31. Oktober fuhren wir mit dem Autobus nach Buenos Aires und erfreuten uns während der gesamten Fahrt an den endlosen Wiesen, Weideplätzen und riesigen Rinder-und Pferdeherden. Am Abend besuchten wir im Theater eine „Tango-Show“, die uns großes Vergnügen bereitete. Am 1. November, also am Tag nach unserer dortigen Ankunft, wurde für uns eine Stadtbesichtigung durch die Landeshauptstadt organisiert. Wir besuchten den „Deutschen Platz“, auf dem jedes Jahr am 3. Oktober alle Feierlichkeiten stattfinden, die mit der Geschichte des deutschen Volkes im Zusammenhang stehen, an denen auch ausländische Botschaften, einschließlich der deutschen, teinehmen. Im übrigen fiel uns auf, dass die Nachfahren der Wolgadeutschen in Argentinien in Bezug auf Deutschland ein besonders warmes Gefühl für die Erinnerung an die vergangene Geschichte ihres Volkes bekunden; überall freute man sich in herzlicher Weise über die Gäste aus Deutschland. Und als sie erfuhren, dass 2004 das 240. Jubiläumder Ausreise der Deutschen aus Deutschland an die Wolga gefeiert werden sollte, versprachen einige sogleich, zu diesem Anlaß mit dem Flugzeug nach Deutschland zu kommen. An jenem Abend trafen wir in Begleitung von Dr. Hartmann in der Stadt San Miguel ein, wo wir um 20 Uhr im Haus der „Freien Gesellshaft der russischen Nachfahren der Wolgadeutschen in Argentinien“ freundlich und feierlich begrüßt wurden; man hatte die argentinische und die deutsche Flagge gehißt, die Tische im Saal waren wunderschön mit den Symbolen beider Länder geschmückt. Unsere argentinischen Landsleute gaben ein kleines Konzert mit Gesang und Tanz in nationalen deutschen Kostümen. Anschließend traten unser Chor sowie Woldemar Hergert und Stefan Klotzel auf, die auf Bajan und Balalajka speilten. Nach dem Konzert unterhielten wir uns an den gedeckten Tischen mit unseren Leuten. Man machte mich mit einem der Schwindts bekannt, mit dem ich lange Zeit versuchte, irgendwelche verwandtschaftlichen Beziehungen herauszufinden, aber es fanden sich keine. Es war sehr angenehm, dass wir alle uns auch ohne harte Getränke stundenlang lebhaft unterhielten und miteinander tanzten. Am 2. November fuhren wir mit dem Bus 350 km weit in die älteste katholische Siedlung der Wolgadeutschen in Argentinien – nach Chinocho, die 1878 gegründet wurde und in der heute 1200 Einwohner leben. In dieser Siedlung gibt es zwei Schulen, eine große Bibliothek, ein Archiv und eine katholische Kirche. Auf der Fahrt wurden wir von Herrn Heit und Dr. Hartmann begleitet. Wir wurden dort in einem Frauenkloster untergebracht. In der Kirche sangen wir einige Kirchenlieder. Am nächsten Tag, dem 3. November, nach dem Frühstück, fuhren wir 260 km weit in südwestlicher Richtung, bis wir die Siedlung Koronel Suarez erreichten. Um 14 Uhr fand dort unsere freundliche Begrüßung statt,und wir wurden zum Mittagessen eingeladen. Es wurden mehrere Begrüßungsreden gehalten: vom Bürgermeister, von Dr. Hartmann, Herrn Heit und Frau Kessler; danach tart der kleine, örtliche Chor vor uns auf, de zwei deutsche Lieder sang, und wir trugen anschließend in der Kirche mehrere Lieder vor. Allerdings war unsere Reise an dem Tag noch nicht beendet – um 16 Uhr setzten wir uns erneut in Bewegung: in Richtung des 240 km entfernten Santa Rosa in der Provinz La Pampa. Unterwegs kamen wir an der Kolonie „Dreifaltigkeit“ vorüber, wo Nachfahren der Wolgadeutschen aus „Wittmann“ an der Wolga leben; leider reichte die Zeit nicht, um hier eine Pause einzulegen, denn wir kamen erst gegen 22 Uhr im Motel „Garden“ an. Nach unserer Verteilung auf die Zimmer und dem Abendessen begrüßte uns der Bürgermeister von Santa Rosa; anschließend (mitten in der Nacht) sang unser Chor noch mehrere Lieder und zum Abschluß sogar gemeinsam mit den anwesenden Zuhörern „Du, du liegst mir ihm Herzen“. Die ortsansässigen jungen Leute sprachen hervorragend Deutsch; sie sangen und tanzten mit uns mit großem Vergnügen. Am 4. November befanden wir uns also in Santa Rosa mit seinen 150.000 Einwohnern, einer der schönsten Städte in Argentinien. Nach dem Mittagessen ging es sehr lebhaft und fröhlich zu, denn unsere dort lebenden Landsleute sangen lustige, alte deutsche Lieder, und ein junger Mann erzählte alte deutsche Witze. Unter den Anwesenden war der alte Aleandro Guinder (Günter?), geboren 1917. Viele Jahre lang sammelte er Materialien zur Geschichte der Wolgadeutschen in Argentinien, und es gelang ihm die Namen der Familien in den einzelnen Siedlungen zusammenzutragen. Mehrfach dankte man uns für unser Kommen und unsere Auftritte, und unserer Chorleiterin Marina Bauer wurden eine Urkunde und ein Buch ausgehändigt. Nach 19 Uhr fuhren wir nach Buenos Aires ab, wo wir um 5 Uhr morgens eintrafen, nachdem wir 608 Kilometer weit gefahren waren. Am 5. November hatten wir einen reien Tag, und wir spazierten selbständig durch die Stadt und die zahlreichen geschäfte. Am Abend wurden wir in einem Restaurant zum Abschiedsessen begrüßt, das (aufgrund eines Organisationsfehlers) in einem Restaurant begann und in einem anderen endete. Es war ein interessanter, bewegender und fröhlicher Abend. Beim Abschied dankte uns Herr Heit für unseren besuch; er sagte, dass wir mit diesem Besuch nicht nur unsere Beziehungen verbessert, sondern auch unser Scherflein zum Erhalt der allgemeinen deutschen Kultur beigetragen hätten. Frau Isabelle Kessler dankte unserem Chor für diese Fahrt und merkte an, dass sie alles mit reinem Herzen für uns getan hätten. Mit warmenWorten antwortete M. Bauer darauf. Am 6. November, um 12 Uhr, fuhren wir mit dem Autobus zum Flughafen, wo uns Herr Heit mit seiner Frau, Frau Kessler, Dr. Hartmann und Herr Danner erwarteten. Zum Abschied sangen wir für sie das Lied: „Muß i denn ...“. Dieses Geschenk hatten sie nicht erwartet.
An den Abenden, nach all den rührenden Begegnungen mit unseren Landsleuten, mit Menschen, denen allen dasselbe Schicksal widerfahren war, konnte ich lange Zeit nicht einschlafen. Ich dachte über das Schicksal unseres Volkes nach: wohin überall hatte das Leben uns nur auseinandergerissen!!! Den einen hatte es nach Amerika verschlagen, den anderen nach Kanada, Brasilien, Argentinien, Paraguay, Uruguay, in die Weiten der ehemaligen Sowjetunion!!! Die meisten Nachfahren der Wolgadeutschen in Argentinien sprechen nur noch Spanisch, sie kennen ihre deutsche Muttersprache nicht mehr, tragen spanische Vor- und Nachnamen. So wie wir in der Sowjetunion meist Russisch sprachen und Mischehen eingingen, so verhält es sich auch in Argentinien. Dort sprechen unsere Landsleute ein akzentfreies Spanisch, sie sind temperamentvoll wie die Spanier,und ihre Sitten und Gebräuche sind ebenfalls spanisch. Aber es freut einen, dass in letzter Zeit zahlreiche Organisationen geschaffen wurden, in denen man sich bemüht, Sprache und Kultur zu erhalten und die jungen Leute und Kinder dafür heranzuziehen. Manch einer spricht noch Deutsch, spricht in demselben Dialekt, in dem wir auch zuhause mit Mama sprachen; dort ist es, als ob die Zeit stehengeblieben wäre. Ich habe so viele bekannte Worte gehört, die ich in der Kindheit gekannt hatte und die inzwischen vergessen sind.
Um 15.35 h flogen wir aus Buenos Aires ab – nach Sao Paulo, wo wir eine Stunde Aufenthalt hatten. Und um 22.15 h landeten wir in Rio de Janeiro. Dort begrüßte uns Claudia – eine Dolmetscherin von „Schwaben International“ (dem deutschen Reisebüro) und brachte uns in ein Hotel an der Copacabana.
Am 7. November fand ine interessante Exkursion durch Rio de Janeiro statt, zur „Christus-Statue“ und dem „Zuckerhut“. Am Abend besuchten wir eine „Samba-Show“ – es war ein farbenprächtiger und temperamentvoller Auftritt. Am 8. November flogen wir um 21 Uhr aus Rio de Janeiro ab, mit Zwischenlandung in Sao Paulo, und am 9. November landeten wir um 14 Uhr in Frankfurt am Main, von wo aus wir mit dem Zug nach Stuttgart zurückfuhren. So ging die wohl interessanteste Reise unseres Chors nach Argentinien, zu unseren Landsleuten, zuende. Wir hatten mit vielen dort unsere Adressen und Telefonnummern ausgetauscht; mitunter telefonieren wir miteinander.
Es ist wichtig, dass in diesem internationalen Prozeß der Detschen aus Rußland so viel wie möglich die deutsche Sprache benutzt wird. Erna Schwindts Schwester Valeria hat die zweifache Deportation der Familie von der Wolga nach Sibirien und aus Sibirien ins Tajmyrgebiet, in die Siedlung Malyschewka, in ihrer Zeugenaussage bereitwillig in beiden Sprachen verfaßt – Deutsch und Russisch.