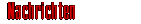

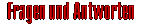



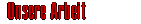




„Wir sind Kinder der Schreckensjahre Rußlands...“
A. Blok
Am 24. Juni 1942 wurden wir mit dem Leichter N° 15, der in einer Karawane von insgesamt 8 Leichtern fuhr, von denen 7 nur halb so groß waren wie der unsere, sowie eines mächtigen dieselbetriebenen Bugsierschiffs namens „Kujbyschew“ in der Siedlung Ust-Chantajka, Bezirk Dudinka, Tajmyr-Nationalkreis, abgeliefert. (Ein Lichter ist ein nicht vollmotorisiertes Flußschiff mit einem Rumpf aus Metall für Lastentransporte). Diese Siedlung heißt so, weil sie sich 18 km unterhalb der Flußmündung der Chantajka befindet, die aus dem „Chantajskoje“-See kommt und nach 90 km in den Jenisej fließt. Dieser Fluß mit seiner schnellen Strömung und einer Breite von 50-100 m besitzt ein hohes steiniges Ufer und zeichnet sich durch sein äußerst sauberes, durchsichtiges, leicht grünes Wasser aus, ähnlich dem der Angara, durch das man sehr gut bis auf den Grund des Flußes blicken kann. Später werden wir uns davon überzeugen, dass es aufgrund dieser Durchsichtigkeit des Wassers vollkommen unmöglich sein wird, im Sommer, wenn die Sonne rund um die Uhr scheint, mit Netzen Fische zu fingen – sie werden von den Fischen umgangen; fischen kann man erst wieder, wenn im August die dunklen Nächte einsetzen.
Also, Ust-Chantajka – das sind vier Häuser, ein Laden mit Vorratslager, eine Bäckerei. Im Laden gibt es ein Zimmer mit Küche und überdachtem Vorbau, das als Unterkunft für die Familie des Verkäufers dient. Am Ufer waren 105 Personen (die 1. Partei) abgeladen worden; man hatte sie aus politischen Motiven und aufgrund ihrer nationalen Zugehörigkeit hierher geschafft: Deutsche aus dem Wolgagebiet und dem Raum Leningrad, Letten, Esten, Finnen, Russen (ehemalige enteignete und nach Sibirien verschleppte Familien), Frauen, Kinder, Halbwüchsige, Alte. All diese Leute, die sich vor der Sowjetmacht mit absolut nichts schuldig gemacht hatten, fanden sich hier, nachdem sie 1941 nach Sibirien ausgesiedelt und 1942 aus Sibirien ins Tajmyr-Gebiet verschleppt worden waren, als sogenannte Sondersiedler und Verbannte (ehemalige Baltikumsbewohner) im Hohen Norden wieder; innerhalb von nur zwei Jahren hatte man sie gleich zweimal deportiert.
Man muß anmerken, dass die hier ortsansässigen Fischerfamilien Tschirkow, Mirgunow und Grischko etwa zum Zeitpunkt unserer Ankunft alle Häuser und sonstigen Gebäude geräumt hatten. Aber das war noch etwas später; einstweilen standen wir am 24. Juni 1942 am hohen, steinigen Ufer des Jenisej und waren von den Mückenschwärmen, die uns umkreisten, schon völlig zerfressen. Das war ein schreckliches Elend – meine Mama reagierte sofort auf die Bisse und Stiche – das ganze Gesicht und die Augen schwollen zu. Die einzige Rettung vor diesen Blutsaugern war der Rauch eines Lagerfeuers und der schnelle Bau einer Laubhütte, um sich vor ihnen in Sicherheit zu bringen; zudem gab es eine Menge Baumaterial – überall lagen nach dem Eisgang und dem späteren Hochwasser angeschwemmte, getrocknete Bretter, Holzstückchen und andere Abfälle des Holzkombinats in Igarka herum. In Bezug auf zurückgelassenes Nutz- und Brennholz entstanden bei uns keine Probleme.
Als wir den Leichter verließen, wurde uns allen noch ein zweimonatiger Vorrat an Lebensmitteln ausgehändigt (eine derartige Fürsorge wurde nur der ersten Partei Sondersiedler, d.h. uns, zuteil). Damals schrieb Jura Jankowitsch, deren Familie (genau wie unsere) aus 3 Personen bestand in ihr Tagebuch, welche Lebensmittel (in kg) sie erhielten: Mehl – 216, Perlgraupen – 18, Schinken – 26,4, Tafelbutter – 7,2, Zucker – 6, Tee - 0,25, Seife – 4,8, Streichhölzer – 60 Schachteln, Pfeifentabak – 12 Päckchen. Einen Monat später (im Juli) war es notwendig, das Mehl an die Bäckerei abzugeben. Man muß zugestehen, dass dies für uns,als Fischer eine große, vorübergehende Lebensmittelhilfe darstellte, welche die nachfolgende 2. und 3. Partie nicht mehr erhielt – und das waren zusammen immerhin 345 Personen.
Die Familien Tschirkow, Mirgunow und Grischko waren, wie wir erst später erfuhren, Kinder ehemaliger, aus politischen Gründen in diese Gefilde verschleppter Eltern, die schon lange tot waren, jedoch eine gutherzige, fleißige Generation hinterlassen hatten. Daher war es nicht verwunderlich, dass diese Leute uns Verständnis und Wohlwollen entgegenbrachten. Die Bekanntschaft mit ihnen verwandelte sich in den nachfolgenden Jahren nicht nur in Freundschaft zwischen den Familien, sondern es kam sogar zu verwandtschatlichen Verhältnissen – meine Tante Minna heiratete den Frontsoldaten und Funker auf dem Chantajka-See – Alekej Mirgunow. Grischko wurde Leiter der Fischfang-Brigade auf dem Sig-See (Sig = Weißfisch, Maräne; Anm. d. Übers.), auf dem Viktoria Walter, meine zukünftige Braut und Ehefrau, ein Jahr lang beim Fischfang tätig war, und die Tschirkows wurden enge Freunde in Potapowo, die uns stets mit großer Wärme empfingen, wenn wir im Winter von Ust-Chantajka nach Dudinka fuhren. Unter den Bedingungen des Hohen Nordens war es bei langen Fahrten wichtig, unterwegs eine zuverlässige Herberge zur Verfügung zu haben. Manche helle Nacht verbrachten wir bei herrlichem Sommerwetter in der Laubhütte, während wir tagsüber am Ufer des Jenisej äußerst schmackhaften wilden, grünen Lauch sammelten und dabei den nahegelegenen See und das Flüsschen erkundeten, das in den Jenisej floß.
Unter den in Ust-Chantajka Abgelieferten befand sich auch eine nicht geringe Anzahl Letten, die bereits auf dem Leichter einen Chor organisiert und vierstimmig lettische Lieder vorgesungen hatten. Ihre Stimmen waren jeden Abend an beiden Ufern des mächtigen Flußes zu hören.
Während die Menschen abgeladen wurden, rief man Natalia Viktorowna Jankowitsch in die medizinische Betreuungsstelle des Leichters und erklärte ihr dort, dass sie mit ihrer Familie hier als Ärztin abgesetzt worden sei, wobei man ihr auch eine gewise Menge Medikamente zur Organisierung einer medizinischen Vrrsorgungsstelle in Ust-Chantajka aushändigte.
Die gesamte Bevölkerung der Siedlung (105 Menschen) wurde in Brigaden zu je 15-16 Personen aufgeteilt, die sich anschließend in den drei vorhandenen Häusern niederließen. Hierzu gehörten auch die drei Fischfangbrigaden (Brigadeführer Eleonora Jorg, Anna Groo und Leo Petri) sowie die beiden Baubrigaden (mit den Brigadeleitern Adolf Kublik und Wladimir Schott). Als Quartier erhielt unsere Brigade das Haus, welches die ortsansässige Familie Grischko für uns geräumt hatte. Auf einer Fläche von 18 Quadratmetern waren 12 Personen untergebracht: Minna Gergenreder (1918), Olga Petri (1898), Leo (1926), Alexander Maurer (1896), Ada (1900), Wladimir (1926), Alexander (1932), Maria Wolf (1896), Amalia (1925), Wladimir (1926), Brigitta Hinz (1927), Thorwald (1925). Wir waren froh, dass es am Haus einen geschlossenen geschlossenen Vorbau mit einem Lagerraum für Brennholz gab, sowie einen Ofen mit gußeisernem Herd. Entlang den Wänden brachten wir 2- und 4- plätzige Pritschen an und stellten zwei Truhen auf, die ebenfalls als Schlafplätze geeignet waren. Um Mama irgendwie vor den gefrässigen Mücken in Sicherheit zu bringen, wurde aus Mull ein Bettvorhang genäht, unter dem man in den hellen Polarnächten Ruhe finden konnte. Mir war es lieber, mein Nachtlager mit Decke und Kopfkissen auf dem 20 Meter hohen Turm (Leuchtturm) mit seinen Schiffszeichen aufzuschlagen, wo es keine blutsaugenden Insekten gab.
Mitte Juli wurden mit einem Motorboot aus der Fischfabrik Dudinka drei Schleppnetze sowie „Puppen“ und Bindfadentrommeln für dieselben in Ust-Chantajka abgeliefert. Unter der Leitung des eingetroffenen Instruktors Bogdanow „bauten“ alle drei Fischfangbrigaden sich jeweils ein 500 m großes Schleppnetz aus Netzen mit einer Maschenöffnung von 35 mm. Zwischen die Stangen wurde das obere und untere Schlepptau gespannt und daran dann ein Netzstreifen von 8 m Breite befestigt, das heißt die Höhe des Schleppnetzes im Wasser sollte 8 m betragen. Mir wurde eine Arbeit zuteil, mit er sich niemand sonst auskannte – aus dem Holz von Laubbäumen (beispielsweise Birken) Nadeln zum Netzeknüpfen zuzuschneiden, denn in jeder Brigade sollte es davon mehrere Stück geben. Ohne solche Nadeln, in die ein grober Faden eingefädelt wurde, konnte man die Netze nicht flicken oder ein zerrissenes Schleppnetz reparieren. Bei der Herstellung dieser Nadeln half mir ein nach der Verhaftung des Vaters im Jahre 1938 erhalten gebliebenes Klappmesser mit Perlmutt-Verzierungen. Sofern es scharfgeschliffen war, konnte man damit die komplizierte Form einer Nadel aus hartem, trockenem Holz mit Öse für den Faden ausschneiden. Nachdem ans obere Schlepptau aus trockenem, gebrannten Holz jeden Meter ein Schwimmer und an die untere Schnur Senkbleie genäht worden waren, stellte Instruktor Bogdanow am 10. Juli 1942 aus acht Jungs und Mädels eine Brigade zusammen, die zum ersten Mal ein Boot bestiegen (es war die Dorfjugend aus den Steppenbezirken des Wolgagebiets); wir begaben uns ans linke, sandige Ufer, um zu fischen. Als wir am Fangplatz angekommen waren, wurde uns klar, dass sich unser Anweiser mit der Technologie des Fischfangs mit einem großen Schleppnetz schlecht auskannte, weil er in der Folgezeit eine Menge Fehler durchgehen ließ: der Fangplatz war zuvor nicht mit Hilfe eines Seils von untergegangenem Strandgut und Steinen gesäubert worden, und deswegen hing das Netz bereits beim ersten Einholen fest und zerriß; aufgrund der schlechten Unterweisung wußte der Fischer an seinem Platz nicht, wie er das Schleppnetz festhalten sollte, damit es nicht mit der Strömung in den Fluß hineingezogen wurde – er, der Bedauenswerte, der bemüht war, so gut es ging mit seinen Händen das Netz zu halten, wurde bis über die Gürtellinie ins Wasser hineingerissen und ließ die Schnur los; als er ans Ufer gelangt war, war er gezwungen, den Stock, den er bei sich hatte, fest in den Sand zu stoßen, um das Schleppnetz eine Schnurlänge vom Ufer entfernt zu halten; infolgedessen wurde das Schleppnetz mit der Strömung in die Tiefe gerissen, verhedderte sich, und wir mußten es ans Ufer ziehen; indessen war der Fischer an seinem Arbeitsplatz vollkommen durchnäßt. Auch wenn das Einholen des Netzes nicht erfolgreich gewesen war, befanden sich im Fangkorb mehrere große Weißlachse und Tajmenlachse. Wir freuten uns alle sehr darüber, denn dieser Erfolg versprach ein Mittagessen, bei dem alle sich sattessen konnten. Diejenigen, die naß geworden waren, begaben sich zum Trocknen ihrer Sachen in die Fischerkate mit den zweistöckigen Pritschen und dem Eisenofen. Da wir zu dem Zeitpunkt noch keine Tüllvorhänge besaßen, ließen uns die beißenden und stechenden Insekten nicht zur Ruhe kommen. In dieser Hinsicht waren der Juli und die erste Augusthälfte im Norden die unangenehmste und unruhigste Zeit – es war unmöglich, sich an diese gräßlichen Kreaturen zu gewöhnen. Tagsüber, während der Arbeit mußte man eine Schirmmütze mit einem Tüllnetz darüber tragen (Gaze war ungeeignet, denn man keuchte darunter vor Hitze, Schweiß und schlechter Luftzufuhr), und nachts hätten eigentlich alle Bettstellen in ihrer gesamten Länge mit einem Gazevorhang verhängt werden müssen. Aber keiner besaß so etwas, außer unserem Instruktor. Als wir vom Fischfang in unsere Kate zurückkehrten, stellten wir mit Schrecken fest, dass wir am Morgen bei unserer Abfahrt aus der Siedlung am Ufer, zwischen den Steinen, unsere Bündel mit Essen liegengelassen hatten – vor allem unser Brot. Während wir uns in der Kate trocknen ließen, wütete auf dem Jenisej ein heftiger Sturm, der ganze Fluß war mit weißen Schaumkronen bedeckt, und es war viel zu gefährlich, um mit dem Boot loszufahren und das Brot zu holen; daher beschlossen wir, unsere Mahlzeit nur mit dem gefangenen Fisch zu bestreiten.
Am vierten Tag hatte sich der Sturm über dem Fluß immer noch nicht gelegt.
Was sollten wir tun? Der Fisch für unsere Mahlzeiten war bereits ausgegangen,
der Himmel mit schwarzen Wolken bedeckt – es weht ein scharfer Nordwind. Außer
dem Fischerboot, mit dem wir das Schleppnetz auswarfen, besaßen wir noch ein
kleines Boot – eine Astrachanka – mit zwei Rudern. Bogdanow will wissen: wer ist
freiwillig bereit, zu dritt mit dem Boot die 7 km bis zur Siedlung zu fahren, um
Lebensmittel zu holen? Es fanden sich drei: Bogdanow am Heck des Bootes als
Steuermann, Petri und Jankowitsch an den Rudern. Der Sturm war in der Tat heftig,
das Boot schleuderte auf den Wellen hin und her, mal sauste es bis an den Fuß
der Welle hinab, mal stand es auf einem Wellenkamm, wo der gefährlichste
Augenblick der war, in dem sich das Wasser ins Boot ergießt. Unser Steuermann
kannte sich mit allem hervorragend aus, einschließlich dem Herausschöpfen des
Wassers aus dem Boot mit einem Eimer. In der Mitte des Jenisej sahen wir, dass
die gesamte Siedlung ans hochgelegene Ufer gekommen war, um uns zu beobachten,
was uns natürlich mehr Mut machte, und als wir schließlich in das kleine
Flüßchen einbogen – da kamen alle zur Begrüßung zu unserem Boot
herabgelaufen und bewunderten unsere kühne Fahrt. Während wir Lebensmittel
erhielten und zu Mittag aßen, wurde der Sturm über dem Fluß merklich ruhiger und
die „Schneehasen“ (Gischt, Schaumkronen; Anm. d. Übers.) verschwanden. Wir
machten uns auf den Rückweg, nun allerdings nur noch zu zweit – Jura Jankowitsch
war krank geworden. An den Fangplatz zurückgekehrt, nahmen uns unsere
„hungrigen“ Fischer mit Freude in Empfang.
Nach dem ersten Versuch mit dem Schleppnetz zu fischen, wurde den drei Brigaden ein solches ausgehändigt, zudem Haken zum Trocknen und Netzflicken sowie je Schleppboot ein 30 m-Zelt, ein Eisenofen, ein Teekessel, ein großer Kochkessel zum Zubereiten von Fischsuppe und eine Bratpfanne; außerdem erhielten sie einige geflochtene Körbe zum Tragen der Fische. All diese zum Fischfang notwendige Ausrüstung bekamen wir von der Fischfabrik in Dudinka, denn bis zu dem Zeitpunkt waren wir Fischer des staatlichen Fischerei gewesen, wobei wir die gesamte Fischausbeute an Sujew, den Leiter der Fischannahmestelle abgeliefert und dafür von ihm Rulons für den Bezug von Lebensmitteln und Industriewaren sowie Geld erhalten hatten. Was ist ein „Rulon“? Das ist ein zusammengerollter Streifen bedruckter Papierkärtchen in der Art von Straßenbahn-Fahrkarten – 2,5 cm breit, auf denen jeweils die Bezeichnung und das Gewicht des Produktes ausgewiesen sind, zum Beispiel: „Mehl 1 kg“ oder „Zucker 0,5 kg“ usw. Sie haben Ähnlichkeit mit einem „Rulon“ – einem Ballen, einer Rolle, von der man die gerade benötigte Anzahl Kärtchen herausschneidet. Der Ankaufpreis in Rubel für 1 kg an die Fischabnahmestelle abgegebenen Fisch war in jenen Jahren, verglichen mit dem Einzelhandelspreis in den Geschäften, äußerst niedrig und hing stark von der Fischart ab: Stör – 3,70, Weiß- und Tajmenlachs – 2,70, große Maränen und Schnäpel – 2,10, Omul – 1,60, Zwergmaränen (der sogenannte „Turuchansker Hering“), Stinte (die sogenannten „Seewölfe“) – 1,10, schwarzer Kleinkram (Aalquappen, Rotfedern, Flußbarsche usw.) – 0,15. Man muß anmerken, dass die Flußfische aus dem Jenisej von hoher Qualität, reinrassig, äußerst schmackhaft und wertvoll sind. Einzelne seiner Arten kann man stets in den zentralen Fischgeschäften in der Twersker Straße in Moskau sehen. „Meine“ Fangbrigade (die „Petrische“) bestand aus 16 Leuten – 2 Einheiten mit jeweils 8 Fischern (4 Jungs und 12 Mädel). Am Fangplatz (der 3 km lang und Teil des gesäuberten Ufers war und an dem der Fischfang mit einem Schleppnetz getätigt wurde) errichteten wir für unsere Brigade ein Zelt, dichteten es gegen die heftigen Winde ab, zimmerten aus grobem Holz Pritschen zusammen, auf die wir mit Gras ausgestopfte Matratzen legten, brachten aus der Siedlung unser eigenes Bettzeug mit und erhielten auf diese Weise eine recht leidliche Behausung mit weitem Ausblick auf den Fluß. Als Brennholzbenutzten wir am Ufer herumliegendes Trockenholz, Äste und kleine Baumstämme.
In der Brigade herrschte, so lange wir bis August 1942 dem staatlichen Fischfang angehörten, völlige Gleichheit, das heißt alle erarbeiteten Rulons, aber auch das verdiente Geld, wurde zu gleichen Teilen verteilt, unabhängig davon, wieviel jeder einzelne zur Arbeit beigetragen hatte. Innerhalb der zwölf täglichen Arbeitsstunden mit dem Schleppnetz gelang es, dieses viermal im Wasser auszuwerfen. Die Zeit für das Mittagessen zählte ebenfalls dazu. Frühstück und Abendessen fanden dagegen außerhalb der Arbeitszeit statt. Gegen Ende des letzten Fangvorgangs mit dem Schleppnetz schickte jede Einheit zwei ihrer Mädchen los, um das Mittagessen sowie Tee für Frühstück und Abendessen vorzubereiten. Einmal pro Woche war die Brigade gzwungen, das Netz zum Trocknen an Haken aufzuhängen, wobei sie gleichzeitig die Maschen flickte sowie verlorengegangene Schwimmer und Senkbleie ersetzte. Für diese Prozedur war eine ganze 12-stündige Schicht notwendig. Einmal in der Woche fuhr die Brigade in die Siedlung Ust-Chantajka zum Badehaus. Das war für uns ein Festtag: Treffen mit den Eltern, Erfahren der letzten Ereignisse im Lande; mitunter erhielten wir dort auch Zeitungen und Zeitschriften und sogar Bücher, die uns dann bei einer günstigen Gelegenheit Mitarbeiter des Bezirkskomitees schickten.
Rundfunkempfang und Elektrizität gab es in der Siedlung nicht. Einmal brachten sie ein Kino – da kurbelten dann die Männer im Wechsel per Hand an einem Elektrogenerator, aber den Film „Die beiden Kämpfer“ schauten wir uns bis zum Schluß an.
Dieses besonders für die Jugend relativ interessante und sogar abenteuerliche
Leben ohne Hunger (denn wir 105 Sondersiedler erhielten einen Lebensmittelvorrat
plus kostenlosen Fisch) währte bei uns nicht lange, insgesamt 25 Tage, denn am
20. Juli 1942 lieferten sie in unserem Ust-Chantajka die zweite Partie Menschen
an – 210 an der Zahl, Menschen unterschiedlicher Nationalität (Wolgadeutsche,
Letten, Esten, Finnen, Ukrainer) und jeden Alters (von Kindern bis zu alten
Leuten), aber das Schlimmste war, dass sie keine warme Oberbekleidung bei sich
hatten (bei der Abreise aus ihrem Heimatort hatten die Begleitsoldaten ihnen
mitgeteilt: „Im Winter kehrt ihr wieder zurück“); aber dann lagen der sibirische
Winter des Jahres 1941und der Tajmyrsker Winter des Hohen Nordens vor ihnen.
Es war entsetzlich für die vom Schicksal gezeichneten Menschen. Man begann
sogleich intensiv mit dem Massenbau von Erdhöhlen. Aber das ist sehr übertrieben
ausgedrückt, denn bei den meisten von ihnen handelte es sich überhaupt nicht um
Erdhütten, sondern eher um Gruben oder Höhlen, die mit grobem Holz, Moos und
Erde bedeckt und etwa 1,5 Meter hoch waren, mit einer Ofenstelle aus Findlingen,
ohne Fenster (es gab kein Glas); und die Beleuchtung gestaltete sich in Form von
Kienspänen (es gab noch nicht einmal Kerosin für ein paar Petroleumfunzeln).
Anfang August 1942 wurde auf einer allgemeinen Versammlung der Bewohner in Ust-Chantajka die Fischfang-Kochose „Thälmann“ gegründet. Später wurde eine solche Bezeichnung für eine Kolchose von den Bezirksbehörden in Dudinka nicht genehmigt, offensichtlich sahen sie darin eine national gemeinte, deutsche Bedeutung. Ohne Einverständnis der Kolchosmitarbeiter erhielt die Kolchose dann den Namen „Nordweg“. Zur Vorsitzenden der Kolchose wurde das Mitglied der Allrussichen Kommunistischen Partei (Bolschewiken) Emilie Erdmann gewählt, zur stellvertretenden Vorsitzenden Minna Gergenreder, Mitglied der Allrussische Leninistisch-Kommunistischen Jugendorganisation, zur Buchhalterin Berta Hammergschmidt und zur Ärztin Natalia Jankowitsch.
In Anbetracht des Anstiegs der Bevölkjerungszahl in der Siedlung auf 315 Personen, ergriff die Kolchosleitung in aller Eile Maßnahmen zum Bau neuer Behausungen. Die Neuankömmlinge besaßen keinerlei Dach über dem Kopf, und der Nordsommer würde innerhalb eines Monats zuende sein (3 Monate Sommer, 9 Monate Winter). Entlang des rechten Flußufers begann die Menschen getrocknete Baumstämme vom Ufer ins Wasser zu rollen und in Richtung der Siedlung zu treiben; dort wurden sie unter größten Anstrengungen von den Frauen ans höher gelegene Ufer gewuchtet, wo sich die eigentlichen Bauplätze befanden. Für zwei Fünfwandhäuser wurden die Grundsteine gelegt. In einem der beiden Häuser wurde der halbe Raum als Kolchoskontor mit zwei Zimmern eingerichtet (das Kabinett für die Vorsitzende und die Buchhalterin und eines für Publikumsverkehr). Die andere Hälfte des Hauses wurde zum Wohnraum mit Pritschen. Das zweite Haus - eine richtige Baracke mit zweistöckigen Pritschen aus unbearbeiteten Birkenstangen – erwies sich bei Einsetzen der Kälte im September als wahrlich ungesunde und stickige Behausung, denn sie war von hoffnungslosen Menschen total überfüllt. Denn am 19. September 1942 hatte das Motorschiff „Sergo Ordschonikidse“ in Ust-Chantajka noch eine dritte, die letzte, Partie Sondersiedler abgeliefert – insgesamt 135 Personen. Die Bevölkerung der kleinen Siedung wuchs auf 450 Bewohner an, obwohl zu der Zeit aufgrund von schweren Erkältungen und Hunger bereits eine Sterbewelle, vor allem von Kindern der 2. und 3. Partie, begonnen hatte.
Der Jenisej war 1942 am 17. Oktober bereits zugefroren. Zu diesem Zeitpunkt hatten die „fürsorglichen“ Behörden aus Igarka einige Flöße mit fertig montierten Zweiwohnungshäusern, gesägten Balken und Brettern nach Ust.Chantajka, Potapowo, Nikolskoje und in andere Siedlungen geschickt, die nun innerhalb kürzester Zeit im Eis des Jenisej festgefroren waren. Natürlich begriffen alle, dass es nun galt, dies Baumaterialien so schnell wie möglich in Sicherheit zu bringen, denn mit dem nächsten Eisgang im Frühling würden sie vernichtet werden. Es begann eine viele Monate dauernde Arbeit des Herausmeißelns und mühsamen Fortschleppens der Baumaterialien auf den Schultern der Frauen ans hochgelegene Ufer, in die Siedlung. Diese armen Frauen konnte man nur mit den Winterflüchtlingen aus der Zeit des 2. Weltkriegs vergleichen: warme Kleidung und Schuhwerk wurden durch Säcke an Beinen und Schultern ersetzt, und das bei Temperaturen von –30 bis –40 Grad. Die Menschen wurden krank und starben massenweise.
Es war nämlich so gewesen, dass die dritte Partie bereits zu einem großen Teil mit schweren Erkältungserscheinungen und anderen Erkrankungen in Ust-Chantajka ageliefert worden war, vor allen Dingen Kinder. In Krasnojarsk wurde das gesamte Sonderkontingent auf einem um ein dreifach überladenes Motorschiff verfrachtet und auf dem Hauptdeck (der sogenannten 4. Klasse) und den beiden offenen Decks untergebrachtet, wo sie der „Gnade“ des herbstlichen Fahrtwinds und dem Nebel ausgesetzt waren. Alle Kajüten und Salons waren mit gewöhnlichen Passagieren belegt, die im Besitz regulärer Fahrkarten waren. Und dann, als das sogenannte Sonderkontingent nach dem gefährlichen, unmenschlichen Transport, ohne warme Kleidung in Ust-Chantajka angekommen war, fanden sie sich plötzlich ohne schützendes Dach über dem Kopf, unter freiem Himmel wieder, das heißt, um es mit den Worten W. Wysozkijs zu sagen: vom Schiff „direkt ins Grab“. Und so geschah es auch – auf der einen Seite mußten unverzüglich Erdhütten gebaut werden, auf der anderen sollten die Flöße mit dem Baumaterial abgeladen werden, um durch Arbeit die nötigen Lebensmittelmarken zu verdienen. Das waren Sklavenbedingungen, unter welche die 2. und 3. Partie der Neuankömmlinge im August und September 1942 fielen. Ganz besonders hatten die Balten zu leiden, die in der Regel keinerlei wärmende Kleidungsstücke besaßen – sie waren in dünnen Kleidchen hergekommen.
Die ganze Last der Hilfeleistung für diese Menschen entfiel auf die Familie unserer Ärztin Natalia Viktorowna Jankowitsch, Tochter Ruta, welche die Aufgaben einer Krankenschwester erledigte, sowie Sohn Jurij. Sie hatten in einer zuvor am Ufer gebauten Erdhütte eine gute medizinische Betreuungsstelle mit zwei Räumen eingerichtet – einem Wohnraum und einem Sprechzimmer für die Kranken. Die tapfere, fleißige und hochgebildete Frau aus Riga, N.V. Jankowitsch, besuchte täglich alle Wohnhäuser, Baracken und Erdhütten und half den Kranken, die unter so furchtbaren Bedingungen ihr Leben fristen mußten.
Sie organisierte das Sammeln von Tannennadeln und ließ daraus ein Gebräu zur Heilung von Skorbut herstellen. Jeder Kranke war verpflichtet täglich ein Glas von diesem sehr bitteren grünen „Gift“ zu trinken. Diese lettische Familie war im Juni 1941 aus der Stadt Daugawa in den Pirowsker Bezirk, Region Krasnojarsk, verschleppt worden, und im Juni 1942 nach Ust-Chantajka. Der Vater wurde 1941 als „Volksfeind“ in Lettland erschossen. Das war das Los der meisten Familien aus dem Baltikum. Gute Hilfe im Baubereich leistete das „Bootsfahrer“-Kommando (wie man die Männer in der Siedlung liebevoll nannte), das auch schon während des Eisgangs und der Zeit des Eisschlamms nicht mehr geschafft hatte, bis nach Igarka durchzukommen und deswegen gezwungen war, sein Boot in unserem Flüßchen zur Überwinterung festzumachen, mit der Überlegung, dass sie sich im Frühjahr mit dem Hochwasser bis zum Eisgang im Flüßchen verborgen halten konnten. Das Kommando, mit seinem Kapitän an der Spitze, zog mit insgesamt fünf Mann selbst die Baumaterialien vom Floß und bauten daraus ein Haus mit zwei Wohnungen, in dem eine Hälfte der medizinischen Betreuungsstelle, die andere als Unterkunft für sie selbst gedacht war. Im darauffolgenden Jahr wurde das gesamte Haus der medizinischen Versorgungsstelle überlassen. Unter den Bootsleuten gab es einen Bajan-Spieler, und die „hungrige“ Jugend organisierte schon ziemlich bald an den Samstagen Tanzabende. Aber die wichtigste Hilfe, die der Bevölkerung der Siedlung durch die Bootsüberwinterung zuteil wurde, kam darin zum Ausdruck, dass der Kapitän seine Vorräte mit der Menge teilte und die Menschen die Möglichkeit bekamen, sich das nötige Wissen anzueignen, wie man von Kienspänen zu Tranfunzeln übergehen konnte. Erst jetzt kann man sich vorstellen, auf was für ein niedriges Lebensniveau die Staatsmacht ein ganzes Volk hatte sinken lassen. Damals ging die Rede nicht vom Überleben, sondern vom Aussterben. Aber das wird erst etwas später deutlich. Die Arbeit der Fischer war äußerst beschwerlich, und nur ein junger, gesunder Organismus konnte einer derartigen Belastung standhalten. Die größte Schwierigkeit dabei lag in dem ständigen Kontakt mit der sie umgebenden rauhen, nördlichen Natur. Trocken bleiben war unmöglich, vor allem wenn am Fluß starker Wellengang oder Sturm herrschte. Übrigens nähern sich Fische gerade in solchen Momenten dem Ufer und der Fang fiel besonders gut aus. Spezialkleidung aus Segeltuch sowie Fischerstiefel erhielten die Fischer nicht. Sie arbeiteten ausschließlich barfuß und waren nur oberhalb der Knie bekleidet; aufwärmen taten sie sich im Frühjahr und Herbst im eisigen Wasser, denn auf dem Festland lag zu der Zeit noch Schnee. Welche Faktoren waren für die Bewertung der Schwierigkeiten beim Fischen besonders maßgebend? Der 12-stündige Arbeitstag bei jedem Wetter, außer bei heftigem Sturm auf dem Fluß, die körperliche Anstrengung bei der Arbeit mit dem 500-Meter-Schleppnetz, das ständige, kräftezehrende Herumschwirren blutsaugender Insekten während der Arbeit, während der Erholungszeiten und im Schlaf, das Tragen nasser Kleidung während der geamten Arbeitszeit, das Arbeiten getrennt von der Familie und unter noch gänzlich unorganisierten Bedingungen und die natürlich bestehenden, ständig zunehmenden Gefahren bei der Tätigkeit im Wasser. All diese Schwierigkeiten beim Fischfang wurden in jenen Jahren noch aufgrund ihres Zwangscharakters der Arbeit sowie der feindlichen und mißgünstigen Haltung seitens der Bezirksbehörden vertieft, wenn wir beispielsweise im Sommer (im Juli), bei einem besonders schwachen Fangergebnis (die ortsansässigen Fischer arbeiteten in der Zeit nicht mit einem Schleppnetz, sondern stellten für ihren Eigenbedarf lediglich Stellnetz auf), verpflichtet waren, trotzdem das ganze Wasser zugunsten des Plansolls „durchzufiltern“, ohne dabei das abgenutzte, teure Schleppnetz zu berücksichtigen. Als Ort wertvoller Nahrungsbeschaffung wurde der Fangplatz ständig von Leitern unterschiedlicher Verwaltungsebenen besucht, so dass die Fischer sich besonders von Seiten der Sonderkommandantur (beispielsweise Hauptmann Stepanow) unter andauernder Kontrolle befanden.
Nachdem in Ust-Chantajka die Kolchose „Nordweg“ organisiert worden war, begann ihre Administration zu wachsen; es tauchten zusätzliche Wirtschafter auf, beim Bau erschienen Vorarbeiter, und bei den drei Fischfangbrigaden ein freigelassener Brigadeleiter. Alle diese Neuerungen verlangten zusätzliche Ausgaben – von den Fischer-Rulons und den Geldeinkünften wurdennun 40% ins Kolchosbudget abgeführt. Im Jahresdurchschnitt betrug die Fischfangquote der Kolchose „Nordweg“ 450 Zentner.
In Ust-Chantajka, meinem zukünftigen „Zuhause“ begleitete mich im Zelt an der Fangstation, während der Arbeit mit dem Schleppnetz oder auch im Winter in der Fischer-Erdütte ständig der Gedanke von der unbedingten Notwenidgkeit eine vernünftige Ausbildung zu erhalten. Von Kindesbeinen an hatte die Atmosphäre in unserer Familie dazu beigetragen, dass Erkenntnisse über alles Neue gefördert wurden und es stets Anregungen zu kreativem Schaffen gab. Meine Kindheit begann in der Ortschaft Bettinger (Baratajewka) in der ASSR der Wolgadeutschen. Mein Papa - Otto Petri (geb. 1893), Buchhalter der landwirtschaftlichen Konsumgenossenschaft, und meine Mama, Olga Petri (Gergenreder, geb. 1898) – Lehrerin, besaßen ihre eigene Hofwirtschaft: ein Haus mit Hofgebäuden, ein Pferd, eine Kuh und zwei Jagdhunde: „Arinok“ und „Milton“; letzterer jagte Enten. Um 1931 der Entkulakisierung zu entgehen, denn ihnen gehörten ein eigenes Pferd und eine Kuh, machten wir uns in der Nacht in aller Heimlichkeit, alles Hab und Gut zurücklassend, zuerst auf den Weg nach Saratow und später nach Moskau zum Bruder des Vaters – Onkel Kolja. Papa fand Arbeit und Unterkunft im Schweinezuchtbetrieb „Budjonowez“, im Dmitrowsker Bezirk, im Umland von Moskau. Der Direktor der Sowchose, Tutychin, war Held des Bürgerkrieges, wurde jedoch aufgrund einer unwahren Denunzierung 1934 verhaftet und als „Volksfeind“ erschossen.
Am 1. Dezember 1934 wurde Kirow ermordert, die Lage im Lande war äußerst angespannt. Meine Eltern beschlossen, sich etwas weiter von all dem „Elend“ zu entfernen – ihren Wohnort ein weiteres Mal zu wechseln. Die Wolga „zog uns zu sich“, und schon sind wir in Astrachan, wo ich übrigens das Alter erreichte, um die erste Schulklasse zu besuchen. Mein Papa war ein leidenschaftlicher Jäger und Fischer. Jeden freien Tag verbrachten wir in der Natur – an der Wolga, in den Flüssen nahe dem Kaspischen Meer. Von einer seiner Reisen nach Moskau brachte Papa mir einen Metallbaukasten der Marke „Konstrukteur“ mit, und seit der Zeit interessierte ich ich für kreatives Schaffen und „wissenschaftliche“ Dinge: in unserem Haus baute ich eine elektrische Eisenbahnanlage mit selbstgebastelter Elektro-Zugmaschine, einen kleinen elektrischen Schweißapparat, um den Rahmen meines Fahrrades mit Kupfer zu schweißen und das Zwei-Zylinder-Modell einer Dampfmaschine mit einem Wasserrohrkessel; dazu diente eine dickwandige, 1,5-Liter-Blechdose, in der früher einmal Ölfarbe gewesen war, und als Brennmaterial – denaturierter Spiritus, und die ylinder waren aus zwei bronzenen Jagdpatronen vom Kalibers 12 mm gefertigt. Als Lehrliteratur gab es die damals unter den Jugendlichen äußerst populäre Zeitschrift „Wissen ist Macht“.
1937 wurde in Astrachan im Gebäude des ehemaligen Holzindustriellen Gubin der städtische Pionierpalast eröffnet. Damals war das ein großartiges Geschenk für die Schüler. Das Gebäude befand sich nämlich in einer vornehmen Gegend im Zentrum der Stadt – an der Strelka, wo der Fluß Kutum in die Wolga fließt, aber das Wichtigste war, dass dieses dreigeschossige, riesige Gebäude über eine herrliche Innen- und Außenarchitektur verfügte. Ich kann mich noch an die wunderschönen, schweren, vor den hohen Fenstern hängenden Vorhänge und die samtbeschlagenen Geländer der Treppen mit den niedrigen Stufen erinnern. Im Foyer war ununterbrochen ein Springbrunnen in Betrieb, der mit schönen Skulpturen geschmückt war. Wir drei Schüler der 5. Klasse – Iwan Tschaschko, Wladimir Krutkow und ich, freuten uns riesig, dass man uns in den Schiffbau-Kreis zugelassen hatte, der von dem erfahrenen Ingenieur und Schiffbauer Golubzow geleitet wurde. Er lehrte uns Schiffbauzeichnungen richtig zu lesen und mit ihrer Hilfe Schiffsmodelle nachzubauen. Jede freie Minute verbrachten wir in diesem Kursus. Innerhalb von drei Jahren bauten wir die Modelle zweier Segel-Ringwaden-Fischerboote sowie die Fluß-Straßenbahn „Moskau“, die einen halben Meter groß und mit einem kleinen Elektromotor ausgestattet war. Ihre Erprobung erfolgte vor dem Pionierpalast auf dem Fluß Kutum, Fotos der Modelle existieren noch. Für die aktive und mit viel liebe getane Arbeit verlieh mir die Jury der städtischen Olympiade der Kinderkreativität eine Ehrenurkunde, die ich ebenfalls bis zum heutigen Tage aufgehoben habe. Das war mein erstes Kinderwerk, das offiziell hervorgehoben und gelobt wurde.
Dennoch ging der stalinsche Terror auch an unserer Familie nicht vorüber: am 13. Juni 1938 wurde in unserem Haus in der Herzen-Gasse 5 in Astrachan mein Papa Otto Petri im Alter von 45 Jahren verhaftet. Von 2 Uhr nachts bis 5 Uhr morgens fand in den Zimmern, im Hof und der Scheune eine Haussuchung statt. Konfisziert wurden ein Jagdgewehr der Marke „Sauer“ samt Zubehör und der goldene Familienschmuck; ferner wurde eine Bestandsaufnahme des gesamten Hauses gemacht (danach besaß Mama nun nicht mehr das Recht, irgendetwas davon zu verkaufen). Bis heute habe ich diesen Anblick (ich war damals zwölf Jahre alt) vor Augen: ein Offizier verlas den Haftbefehl – „.... auf Anordnung .... Petri, Otto Iwanowitsch, Deutscher, geboren 1893, ist hiermit verhaftet....“. „Wen möchten sie als Zeugen haben?“ – „Meinen Nachbarn Alexander Afanasjewitsch Piwzow“, - antwortete Papa. Als er das Haus verließ waren seine letzten Worte: „Ljowuschka, hör auf die Mama!“ – In der Situation brachte Papa mit diesen drei Worten zum Ausdruck, dass er den Glauben an jedwede Gerechtigkeit verloren hatte und dass man ihn nicht wieder nach Hause zurückkehren lassen würde. Wieviel Tränen vergoß Mama damals jeden Tag, wenn sich der Uhrzeiger auf 5 Uhr abends zubewegte und der Vater normalerweise von der Arbeit heimgekommen wäre. Im Sommer hatte ich ihn oft um diese Zeit an der Straßenbahn-Haltestelle beim Fischgeschäft abgeholt, und natürlich kaufte er mir dann mein geliebtes „Eskimo“-Schokoladeneis am Stiel für 60 Kopeken; und anschließend tranken wir noch für 10 Kopeken leckeren, kalten „bayerischen“ Kwas. Manchmal, wenn er von der Arbeit gekommen war, begann der Vater mich argwöhnisch zu umkreisen. Nach dem Abendessen nahm er mein Hausaufgabenheft und sagte, während er die Noten betrachtete: „Für dein gutes Lernen, Ljowuschka, hast du dir ein Reißzeug verdient“. In jenen Jahren war das ein wertvolles Geschenk für einen Schüler der vierten Klasse. Dieses Zeichenbrett leistete mir während der gesamten Schulzeit, in den Studentenjahren und während meiner Aspirantur gute Dienste. Papa hatte zwei Zeitungen abonniert – die zentrale „Iswestija“ und die Lokalzeitung „Der Kommunist“. Noch bevor ich zur Schule kam, hatte Papa es immer sehr geliebt, mir Puschkins Märchen und deutschsprachige Gedichte von Schiller vorzulesen. Bei uns zuhause hatten wir ein Grammofon mit einer großen Auswahl Schallplatten (ich kann mich an eine von ihnen erinnern – darauf gab es ein Lied mit dem Wortlaut: „Am Samowar singen Mama und ich laut ein Lied, draußen ist es schon dunkel“) sowie den damals besten Rundfunkempfänger SWD-e, den Onkel Kolja uns aus Moskau geschickt hatte. Papa war sehr naturverbunden und ein erfolgreicher Fischer und Jäger. Seinen gesamten Urlaub nahm er im Oktober, wobei er es so einrichtete, dass der letzte Urlaubstag auf den Vorabend der drei Tage dauernden Oktoberfeierlichkeiten fiel. In dieser Zeit war an der Wolga-Mündung der Fischfang mit Netzen und die Jage auf Wasservögel erlaubt. Mit unserem Motorboot, das zwei Meister des „Bootsbaufachs“ 1935 bei uns im Hof gebaut hatten, ausgestattet mit einem schwedischen Zweitakter der Marke „Bolinder“, 5 PS, mit Erdöl betrieben, 600 Umdrehungen pro Minute, mit Kajüte und Segel, fuhren Papa, Fjodor Fjodorowitsch Klein, seinem Arbeitskollegen Smirnow und Jagdhund Alfa über die kleinen Flüßchen in Richtung Meer. Nach der für gewöhnlich erfolgreichen Rückkehr nach Hause wurde Mama dann die größte Arbeit zuteil – die Fische mußten möglichst schnell geräuchert, Enten und Gänse verarbeitet werden. In unserem Ofen auf feinsten Holzspänen heiß geräucherte Karpfen war lange haltbar und schmeckte wunderbar. Auch die Vögel wurden geräuchert. Unser gesamtes Bettzeug war ausschließlich mit Daunen gefüllt (1941 tauschte Mama sie in Sibirien gegen Kartoffeln und Mehl ein). Papa hörte sehr gern klassische Musik. Ich weiß noch, dass 1937 das Staatstheater für Oper und Ballett aus Moskau mit seinem Leiter Stanislawskij in Astrachan ein Gastspiel gab. Meine Elternbesuchten das gesamte Programm.Die Aufführungen fanden im besten Sommertheater, dem „Arkadij“, amUnterlauf der Wolga statt. Sehr schade, dass dieses Meisterwerk hölzerner Baukunst in den 1960er Jahren während eines Feuers vollständig niederbrannte und bis heute nicht wiedererrichtet wurde. Papas unverschuldeter Untergang wirkte sich stark auf Mamas Gesundheit aus, aber ich unterstützte sie durch mein fleißiges lernen. Wenn ich in der 5. Klasse von einer der üblichen Prüfungen nach Hause zurückkehrte und an die Tür klopfte, dann fragte Mama stets: „Wer ist da?“ – Und ich antwortete: „Sehr gut!“ Ich konnte mich nicht erinnern, dass ich jemals „gut“ sagte.
Papas Urteil wurde am 20. Oktober 1938 vollstreckt. Am 31. Dezember 1957 wurde er posthum wegen Mangel an Tatbeständen rehabilitiert. Als ich viel später schon in Moskau lebte, kam der unüberwindliche Wunsch auf, einmal Papas Strafakte einzusehen, sich mit ihr vertraut zu machen, um zu begreifen, wie es möglich gewesen war, ein Urteil mit Tod durch Erschießen zzu verhängen, wenn doch überhaupt kein Tatbestand vorgelegen hatte. In den 1970er Jahren (allem Anschein nach: in den 1990er Jahren – Anm. d. Redakteurs der Web-Seite) bekamen meine Frau Viktoria und ich, aufgrund meines Gesuchs in Moskau die Möglichkeit, Einblick in die Strafsache meines Vaters zu nehmen, die uns das Astrachaner Regionsgericht des MWD zusandte. In der Lubjanka wurden wir im Kabinett eines Oberst höflich begrüßt, der uns Papas Akte N° 10016 mitbrachte, die von der Astrachaner NKWD-Regionsbehörde aufgrund von §58-1a des Strafgesetzes der RSFSR für Otto Iwanowitsch Petri, Deutscher, geboren 1893, arrestiert am 13. Juni 1938, Urteil vollstreckt am 20. Oktober 1938, angelegt worden war. Während der Oberst den Ordner durchblätterte, der buchstäblich aus nicht mehr als zehn Blättchen Papier bestand, riß er Papas Ausweis und seinen Gewerkschaftsmitgliederausweis mit seinem Foto aus der „Akte“ und gab uns alleszum Mitnehmen; die Heftmappe aber überließ er uns zum Lesen. Viktoria las unter Tränen. Verhört worden war Papa nur ein einziges Mal von einem operativen Bevollmächtigten der UGB des Astrachaner NKWD-Regionsbehörde, einem Unterleutnant namens Lisizyn – am 25. Juni 1938. Der Oberst lenkte unsere Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass das Verhörprotokoll, welches Lisizyn aufgezeichnet hatte, keinerlei Korrekturen aufwies, sondern offensichtlich sofort ins Reine geschrieben worden war, was bei Verhören mit Verhafteten sonst keineswegs üblich ist; das heißt – das Verhör war gefälscht. Mit Genehmigung des Oberst machten wir mehrere Kopien von den für uns „wichtigsten“ Dokumenten:
1. N° 34495 vom 2. August 1934, Moskau. Derschinskij-Platz, NKWD an Sarin,
Stalingrad, NKWD-Verwaltung der UdSSR für das Gebiet Stalingrad. Aus Moskau ist
zur dauerhaften Arbeitsaufnahme in Astrachan abgereist: der Teilnehmer einer
konterrevolutionären, faschistischen Formierung von Deutschen, die mit der
deutschen Botschaft in Moskau in Verbindung stehen und geheime Informationen
über die Lage der Deutschen in der UdSSR weitergegeben haben – Herr Otto
Iwanowitsch Petri, ehemaliger Händler und Kulak. Die Sonderabteilung der GUGB
bittet darum, O.I. Petri schnellstens unter Beobachtung zu stellen und zu
bespitzeln, wobei besondere Aufmerksamkeit auf die Aufeckung seiner
innerstädtischen astrachaner Verbindungen zu richten ist. Gegen O.I. Petri und
die mit ihm in Verbindung stehenden Personen ist ohne unsere Sanktionen nichts
zu unternehmen.
Assistent des Leiters der geheimen politischen Abteilung der GUGB (Gorb).
2. Dem regionalen astrachaner NKWD liegen Beweise über O.I. Petris Verbindungen zur deutschen Botschaft vor....
3. Alexander Fjodorowitsch Petri (Namensvetter), ehemaliger Mühlenbesitzer, entkulakisiert, hält sich seit 1929 bis heute versteckt. Seine Familie lebte 1930 in der Stadt Wolsk und 1931 in Moskau, in der Wohnung von Reinhold Iwanowitsch Petri (es ist unverständlich, in welchem Bezug dieser Namensvetter zu Papas Strafakte stand).
4. An den Leiter der Registratur- und Archivstelle des der KGB-Verwaltung in
der Region Krasnojarsk. Wir bitten darum, Herrn Leo Ottowitsch Petri mitzuteilen,
dass sein Vater Otto Iwanowitsch Petri, geboren 1893, am 28. September 1938 zu
10 Jahren Arbeits- und Erziehungslager verurteilt wurde und, während der
Strafverbüßung, am 20. Januar 1944 an seinem Haftort an Herzstillstand
verstorben ist. Wir bitten darum, uns das Datum der Bekanntmachung mitzuteilen.
Leiter der Registratur- und Archivstelle der Sonderabteilung der KGB-Verwaltung
im Gebiet Astrachen, Oberstleutnant Anoschkin.
Dieser Brief ist erlogen, denn Papa wurde am 20. Oktober 1938 erschossen und starb nicht erst 1944 im Lager.
5. An den Leiter der Milizverwaltung im Gebiet Astrachan. N° 8-1-011 vom
04.12.57.
Unter Bezugnahme auf die Verfügung N°108, streng geheim, bitte ich um Ihre
Weisungen, den Tod des Herrn O.I. Petri beim städtischen astrachaner Standesamt
registrieren zu dürfen, der während seiner Strafverbüßung am 20. Januar 1944 an
seinem Haftverbüßungsort an Herzversagen starb.
Zu übersenden an den Sohn in Krasnojarsk.
Leiter der KGB-Verwaltung im Gebiet Astrachan,
Oberst Ochapkin.
Dieser Brief stellt eine Fortsetzung der Lügen-Version des vorangegangen Schreibens dar.
6. In Sachen der Rehabilitation meines Vaters machten zu seiner Verteidigung 1957 folgende Zeugen ihre Aussagen:
A.A. Liwzow, der in seinem Verhörprotokoll aussagte, dass O.I. Petri ein
netter, liebenswerter Mann war, der sich niemals für politische Themen
interessiert oder über sie gesprochen hätte. Wir sind Nachbarn und Freunde
gewesen, haben abends auf dem Erdaufwurf vor dem Haus gesessen, ein kühles Bier
getrunken, über Stadtneuigkeiten gesprochen, über die Wolga und den Fischfang,
wir mit unseren Familien die freien Tage in der Natur zu verbringen pflegten.
O.I. Petri kann kein Verbrecher gewesen sein, er wurde ein Opfer der
Gesetzlosigkeit. Als weitere Zeugen traten auf: A.K. Munz, M.A. Gerlach, W.W.
Pustowaja, J.I. Kiseljow,
und A.I. Gergenreder – sie charakterisierten ihn ausschließlich mit positiven
Eigenschaften.
7. Zusammen mit Papa wurden des weiteren zu Opfern: F.F. Klein (Hauptbuchhalter bei der städtischen Handelsbehörde in Astrachan), erschossen am 28. September 1938; K.L. Munz (Hauptbuchhalter bei der Nord-Kaspischen-Fischerei-Vertriebsgesellschaft). erschossen am 28. September 1938.
8. Anordnung einer „Trojka“ der NKW-Behörde der Region Stalingrad vom 28.
September:
a) O.I. Petri – Tod durch Erschießen, b) Konfiszierung des gesamten Besitzes.
Das Urteil ist endgültig; es kann keine Berufung eingelegt werden.
9. Papas Urteil wurde am 20. Oktober 1938 vollstreckt. In seiner „Akte“ finden sich drei Unterschriften der „Trojka“ sowie eine vierte, die von dem Arzt stammt, der nach der Erschießung Papas faktischen Tod bestätigte.
10. In der „Akte“ befidet sich zur Frage der Rehabilitierung eine Schlußbemerkung des Militärtribunals: „Materialien, die als Grundlage für die Verhaftung Otto Iwanowitsch Petris dienten, wurden in der Strafakte nicht gefunden. Es gab lediglich ein einziges Verhör am 25. Juni 1938. Die Aussagen des Angeklagten O.I. Petri wurden während des Ermittlungsverfahrens nicht überprüft“.
Es wird also deutlich, dass es für Papas Verhaftung, und schon gar nicht für die Anwendung irgendwelcher repressiven Maßnahmen gegen ihn, überhaupt keine Veranlassung gab! Nachdem wir Papas „Akte“ N° 10016 durchgelesen und uns Notizen gemacht hatten (unser Besuch beim KGB dauerte eine Stunde und vierzig Minuten), waren bei Viktoria und mir gemischte Gefühle enstanden: einerseits wollten wir uns so schnell wie möglich aus diesem vom ganzen russischen Volk verdammten, im Zentrum Moskaus gelegenen, grauen Gebäude der Tscheka, der OGPU, des NKWD und des KGB entfernen, in das Menschen, gegen die ein Untersuchungsverfahren vorliegt wohl hineingehen, aber niemals wieder herauskommen; andererseits wollten wir so genau wie möglich alles über Papas „Schuldhaftigkeit“ herausfinden. Bis heute bedaure ich sehr, dass ich nicht wenigstens einige Seiten aus diesem „Protokollwerk“ des einzigen Verhörs meines Vaters vom 25.06.1938 abgeschrieben habe, denn der KGB-Oberst, der uns in seine Sprechstunde gebeten und uns gegenüber sein „Mitleid“ gezeigt hatte, hatte uns nicht verboten Notizen zu machen. Aber die innere Angst vor dem Gedanken „wo wir uns hier befanden“ zog uns so schnell wie möglich wieder auf die Straße hinaus, die nervliche Belastung in diesen Mauern war einfach zu groß. Der „gute“ Oberst brachte uns anläßlich der Tatsache, dass Papa unschuldig umgekommen war, sein Mitgefühl zum Ausdruck. Er sagte: “Gott sei Dank, dass jene Jahre der staatlichen Willkür niemals wiederkehren werden“. Ja, das gebe Gott! Nach unserem Besuch bei den Tschekisten begaben wir uns in die nebenan gelegene Grünanlage am Politischen Museum und setzten uns neben dem Stein „Zum Gedenken an die Opfer politischer Repressionen 1917-1950“ nieder, um dort schweigen und das Erlebte verarbeitend, langsam wieder zu uns zu kommen. Nachdem wir vollständigen Einblick in die „Akte“ genommen hatte, müssen wir zugeben, dass es nach dem Verständnis der post-stalinistischen Zeit keinerlei Straftatsbestand gegeben hat und seine Rehabilitierung von daher absolut richtig war. Bringt man jedoch die Anklageschrift mit der Terrorperiode der Jahre 1937-38 in Zusammenhang, als Menschen aufgrund ihrer nationalen Zugehärigkeit der Verfolgung ausgesetzt waren, dann war Papas deutsche Nationalität das schlimmste Verbrechen in der Anklage, obwohl Nationalismus weder in der offiziellen Propaganda noch in der Verfassung der UdSSR als krimineller Tatbestand verfolgt wurden. Aber die Entscheidung der Kreml-„Führer“ lautet anders: ein Deutscher – den muß man verfolgen und sich seiner entledigen.
Wir haben Papas „Arbeitsverzeichnis“ (heute nennt man es „Arbeitsbuch“) aufbewahrt, das 1937 ausgefertigt wurde und Auskunft über seine Tätigkeiten in der Sowjetzeit bis zu seiner Verhaftung gibt. Dieses offizielle Dokument zeigt, dass seine Arbeit nichts gemein hat mit jenen Eigenschaften, die in seiner Straf“akte“ N° 10016 genannt wurden. Weiter unten führen wir diese Liste auf - Nachname, Vorname, Vatersname: Petri, Otto Iwanowitsch. Allgemeine Angaben über den beruflichen Werdegang:
1. Geboren am 1. Dezember 1893.
2. Nationalität: Deutscher.
3. Soziale Lage: Beamter (Bescheinigung vom Baratajewkser Dorfrat vom 18. Juni
1931).
4. Ausbildung: nicht abgeschlossene Mittelschule
5. Beruf: Buchhalter.
7. Gewerkschaftsmitglied seit 1918 (Mitgliedsausweis N°. 21480-0009).
Als Soldat registriert: 2. Reihe, 1. Gruppe, 1. Kategorie (Personal-Buch).
Angaben über geleisteten Wehrdienst:
1. 1915-17 Gewöhnlicher Soldat der alten Armee (Personal-Buch der Roten Arbieter-
und Bauern-Armee, Kriegskommissariat Marxstadt).
2. 1918-21 Buchhalter bei Mnogolowka (Bescheinigung vom 2. November 1921).
3. 1922-24 Bevollmächtigter des Gebietshungerkomitees (Mandat vom 24. März
1924).
4. 1924-26 Buchhalter der Tabakfabrik „Traktor“ (Bescheinigung N° 5192 vom 10.
Februar 1926).
5. 1926-29 Buchhalter der landwirtschaftlichen Genossenschaft (Abberufung N° 202
vom 15. Juli 1929).
6. 1929-30 Buchhalter im Baratajewsker Bezirk, bei der Tabakgenossenschaft (Abberufung
vom 20. Juni 1930).
7. Buchhalter der Kolchose „Spartakus“ (Abberufung N° 491 vom 5. Oktober 1931).
8. Oktober 1931. Arbeitsantritt bei der Dmitrowsker Schweine-Sowchose als
Oberbuchhalter (Befehl N° 9 vom 1. November 1931).
9. 5. April 1934 Auf persönlichen Wunsch gemäß Antrag aus seinem Amt
freigestellt. (Befehl N° 147 vom 4. April 1934). Unterschrift des Direktors der
Sowchose – Stempel.
10. 22. September 1934. Eingestellt bei der Nord-Kaspischen
Fischerei-Absatzgesellschaft als Oberbuchhalter der Sammelstelle. (Befehl N° 165
der Nord-Kaspischen Fischerei-Absatzgesellschaft). Mit diesen Angaben über die
berufliche Laufbahn endet die „Arbeitsliste“, denn am 13. Juni 1938 wurde Papa
von der Astrachaner NKWD-Regionsbehörde verhaftet. Für seine dreieinhalbjährige
aktive und gute Arbeit in der Nord-Kaspischen Fischerei-Absatzgesellschaft
erhielt Papa mehrmals Prämien; auch darüber finden sich in der „Arbeitsliste“
folgende Eintragungen:
11. 21. März 1935. Prämiert mit 450 Rubel für aktive Teilnahme an der Erstellung
der Jahresbilanz für das Jahr 1934 (Befehl N° 26 vom 21. März 1935).
12. August 1935. Prämiert mit 650 Rubel für seine Arbeit im 2. Quartal (Befehl N°
71 vom 1. August 1935).
15. 23. Februar 1936. Für seine Arbeit an der Jahresbilanz prämiert mit 326
Rubel (Befehl N° 228 vom 23. Februar 1936).
18. 25. Januar 1937. Prämiert mit der Simme von 325 Rubel für die Erstellung der
Jahresbilanz 1936 (Befehl N° 22 vom 25. Januar 1937.
Papa war in seinem Leben ein aktiver Mann. In diesem Zusammenhang muß man seine Aufmerksamkeit auf Punkt 3 seiner „Arbeitsliste“ lenken. Wie bekannt, wütete Anfang der 1920er Jahre, im Zusammenhang mit der allgemeinen Konfiszierung von Getreide, einschließlich des Saatgutes, bei den Bauern sowie des von Lenin eingeführten „militärischen Kommunismus, im Lande eine schreckliche Hungersnot, welche auch das gesamte Wolgagebiet erfaßte. Die deutschen Kantone biledeten ein Komitee zum Kampf gegen en Hunger – das sogenannte „Obkomgol“, das Gebietshungerkomitee. Einer seiner Leiter war Papas Bruder Nikolaj Iwanowitsch Petri, der die aktive Jugend um sich versammelt hatte (Theodor Iwanowitsch Walter, Viktor Abramowitsch Rusch, Otto Iwanowitsch Petri u.a.). Mit Nagan-Pistolen bewaffnet (im Süden des Landes waren zu jener Zeit Räuberbanden unterwegs), fuhren sie mit dem Mandat des „Obkomgol“ von Pokrowsk (später die Stadt Engels) nach Baku, um dort Reis zu beschaffen. Die Reise gestaltete sich erfolgreich –in die Stadt Pokrowsk rollten mehrere Waggons dieses wertvollen Nahrungsmittels. Von denen Bevollmächtigten des Komitees, die den Zug begleiteten, blieben alle von Bandenüberfällen verschont. Wie in der „Arbeitsliste“, die 1937 über Papas Tätigkeiten in der Sowjetzeit bis zu seiner Verhaftung erstellt wurde, aufgeführt, wirkte Papa im Zeitraum 1922-24 innerhalb des Systems dieses Komitees aktiv an der Rettung der Menschen vor dem sicheren Hungertod mit.
Mama (1898-1976) machte sich nach Papas Verhaftung ihr ganzes restliches Leben lang Vorwürfe, dass sie, in Anbetracht der damals im ganzen Lande und in Astrachan auch an Nachbarn und Mitarbeitern durchgeführten Massenverhaftungen (besonders von Personen deutscher Nationalität, wie beispielsweise der Hauptbuchhalter an Papas Arbeitsstelle – Munz, Freund Klein u.a.), nicht noch ein drittes Mal an einen anderen Wohnort umgezogen waren! Hatten sie Papa gegenüber vielleicht Mitleid gehabt – wegen seines Eigentums, seines Hauses, seinem Motorboot u.a.? Oder waren die frühere Seelenstärke und das Gefühl, herannahende Gefahren rechtzeitig zu erkennen, derart abgestumpft? Ich kann mich noch gut daran erinnern (ich war damals 12 Jahre alt), wie eine Eltern sich über dieses Thema unterhielten. Papa sagte damals: „Ich kann wohl verstehen, dass wir in aller Heimlichkeit aus Baratajewka fortgegangen sind, denn als Besitzer eines Pferdes und einer Kuh hätten sie uns „entkulakisieren“ und an jeden beliebigen Ort verschleppen können. Aber jetzt – wofür sollten sie mich denn verhaften, mich, einen ehemaligen ordentlichen Beamten im Staatskontor der Fischbranche? Ich habe mich vor dem Staat keines einzigen Verbrechens schuldig gemacht!“ Papa konnte sich nicht vorstellen, dass man einen unschuldigen Menschenverhaften könnte. Von seiner „Schuld“ ein Deutscher zu sein war damals, in den 1930er Jahren, in der Sowjetpropaganda überhaupt keine Rede, um so mehr, als sich, wie man weiß, zwischen der Politik Stalins und Hitlers eine Annäherung vollzog. All das zusammengenommen hatte Papas „Wachsamkeit“ in puncto Familie abgestumpft. Später dann, nachdem Papa nicht mehr da war, wurden Mama und ich, ebenso wie Millionen anderer Menschen, unschuldig aus politischen Motiven und aufgrund unserer Nationalität repressiert.
Bis an unser Lebensende wird unsere ganze Familie – ich (geb. 1926), meine Ehefrau Viktoria (geb. 1925), Sohn Viktor (geb. 1950) seine Ehefrau Natalia (geb. 1953), ihre Kinder – Tochter Julia (geb. 1976) und Sohn Nikolaj (geb. 1981) – dem lieben Papa, Großvater und Urgroßvater, Otto Iwanowitsch Petri, ein ehrendes Andenken bewahren. Er wurdenach seiner Erschießung am 20. Oktober 1938 in irgendeinem Massengrab zusammen mit anderen „Volksfeinden“ der Astrachaner NKWD-Regionsbehörde beerdigt.
Der Drang nach Wissen begleitete mich mein ganzes Leben. Und da, als ich im Frühjahr 1944 in Ust-Chantajka in der Zeitung „Sowjetskij Tajmyr“ eine Information darüber fand, dass in Norilsk ein Technikum für Bergbau und Hüttenwesen eröffnet werden sollte, schickte ich sogleich meine Bewerbungsunterlagen dorthin, zumal ich das Recht besaß, ohne Aufnahmeprüfung angenommen zu werden, denn ich hatte 1941 in Moskau die 7. Klasse als Bester beendet. Unterrichtsbeginn war der 15. Oktober 1944. Zwischen den Schichten beim Fischfang begann ich im Zelt zu lesen und mich der Mathematik und Physik zu erinnern, denn zum Glück hatten sich entsprechende Lehrbücher gefunden. Das Leben verlief wieder ein wenig fröhlicher.
Allerdings ergaben sich bei mir zwei Probleme: Viktoria und ich mußten unsere Freundschaft nun aus der Ferne weiterpflegen. Wir hatten uns ein halbes Jahr zuvor, am 17. Dezember 1943 kennengelernt und uns in der frostigen Polarnacht, bei hellem Mondschein und den Elmsfeuern des Polarlichts unsere Liebe gestanden. Es war für uns beide die allererste zärtliche Freundschaft und Liebe, die ein ganzes Leben lang andauern sollte. Das andere Problem war, dass ich eine Kolchos-Becheinigung vom Arbeitsplatz zur Vorlage am Technikum benötigte. Die Jagd nach dieser Bescheinigung zog sich den ganzen Sommer hin, bis in den September hinein – die Vorstandsvorsitzende der Kolchose „Nordweg“, Emilie Erdmann“ wollte ihren Brigadeführer nicht fortlassen: Aber – Not macht erfinderisch, und so erhielt ich zusammen mit der Bescheinigung auch gleich Arrest, den der Kommandant der Sonderkommandantur, Hauptmann Stepanow, über mich verhängte: es hat sich herausgestellt, dass der Kolchosverstand (Erdmann) sich mit dem Ansuchen an die Sonderkommandantur der Tajmyrsker NKWD-Behörde gewandet hat, ein strafrechtlichesVerfahren gegen mich einzuleiten, weil ich als Brigadeleiter angeblich das Schleppnetz ruiniert hätte.
Der Kommandant der Sonderkommandantur, Hauptmann Stepanow, gab mir nur 10-15 Minuten zum Packen meiner Sachen, damit ich noch rechtzeitig an Bord des vorbeifahrenden Dampfers „Maria Uljanowna“ kam, um unter seiner Aufsicht nach Dudinka zu fahren. Die Schiffssirene hatte bereits einmal Signal gegeben. Unterwegs war Zeit, um noch einmal von Anfang an über die seit meiner Kindheit ständig in der Familie herrschende Angst nach dem Arrest und der Erschießung von Onkel Kolja in Moskau im Herbst 1938, der Verhaftung am 13. Juni desselben Jahres und der anschließenden Erschießung meines Vaters nachzudenken – beide waren sie als „Volksfeinde“ hingerichtet (und 1957 rehabilitiert) worden. Und da fahre ich nun im Alter von 18 Jahren geradewegs ins Gefängnis. In Dudinka konfiszierte Stepanow von mir in der NKWD-Gebietsbehörde sämtliche Lebensmittelkarten, Geld, meinen Füllfederhalter und den Gürtel. Ein Milizionär brachte mich anschließend in die Untersuchungszelle im Gefängnis von Dudinka. Inder Zelle empfing mich ein auf der Pritsche zusammengekauert dasitzender junger Mann. Ich spendierte ihm ein wenig Brot, Tafelbutter und Zucker. Nachdem er von meinem Kummer gehört hatte, verkündete er ohne Vorbehalt, dass mein Fall sich auf den § 220 des Strafgesetzes (Nachlässigkeit) bezog. Aber man würde mich unter einer einzigen Voraussetzung nicht nach diesem § Paragraphen verurteilen: ich dürfte kein einziges Stück Papier unterzeichnen, das man mir vorlegte – das würde meine Freiheit garantieren.
Ich schenkte meinem mitgefangenen Advokaten Glauben. In der ersten Nacht rief Stepanowmich heraus, und nachdem er mir meine aus mehreren Blättern bestehende Akte zum Lesen gegeben hatte, verlangte er, dass ich meine Unterschrift darunter setzen sollte. Nun wußte ich, „wo der Hund begraben lag“. Es stellte sich heraus, dass ich als Brigadeführer das Schleppnetz ruiniert haben sollte; dazu hatte der Kolchosvorstand Vergleiche angestellt, wo es überhaupt nichts zu vergleichen gab: das Schleppnetz meiner Brigade wurde mit den Netzen der beiden andern Brigaden verglichen, aber sie waren einfach nicht miteinander vergleichbar, denn unser Netz war bereits seit zwei Jahren in Benutzung (es war noch dasselbe Netz, das auch schon unser Instruktor Bogdanow benutzt hatte), während die Netze der beiden anderen Brigaden erst ein Jahr ihre Dienste geleistet und demzufolge viel weniger Abnutzungserscheinungen davongetragen hatten und in einem wesentlich besseren Zustand waren als unseres. Dabei hatte der Vorstand „vergessen“, dass eben jener Vorstand unsere Brigade vor Beginn der Saison im Frühjahr 1944 auf einer allgemeinen Kolchos-Versammlung dafür gelobt hatte, dass bei unserem Schleppnetz, trotz seines bereits zweijährigen Einsatzes, viel weniger Reparaturen vonnöten waren, als bei anderen Netzen. Ein Vergleich der Reißfestigkeit der Netzfäden bei einem fast doppelt so langen Verbleib im Wasser mit dem Abnutzungszustand der anderen Schleppnetze war einfach nicht zulässig. Ein Netz, das sich zweimal so lange im Wasser befunden hatte, war bei ansonsten gleichen Bedingungen natürlich schneller abgenutzt. Daher ging das Konzept des Kolchosvorstandes bei der Bewertung des Schleppnetzes unserer Brigade hinten und vorne nicht auf. Auf dieser Grundlage weigerte ich mich dann auch gegenüber Stepanow, die Anklageschrift zu unterschreiben. Auf seinGeschrei und seine Drohungen reagierte ich nicht. Allerdings ließ er es auch nicht zu Handgreiflichkeiten kommen. Ein wenige Tage später durchgeführtes Verhör führte zu keiner Änderung in meinem Verfahren. Mein „Zellenkamerad“ triumphierte.
Nachdem ich eine Woche eingesessen hatte, kam ein Milizionär und brachte mich zum Bezirksgericht, wo mich der Richter in Empfang nahm, der alte Lebedew mit seinen schlohweißen Haaren. „Na, Petri, dann erzähl’ mal, was du angestellt hast.“ - Ich berichtete ihm, dass unsere Brigade in puncto Anzahl, Zeit und Qualität den gesamten technischen Ablauf bei der Nutzung des Schleppnetzes genauestens eingehalten hätte und dass die seitens des Kolchosvorstands vorgebrachte Beschuldigung von daher völlig unbegründet sei, so dass ich mich im Falle der vorliegenden Anklageschrift auch keineswegs schuldig fühlte. Der Richter meinte: „Du bist frei!“ und rief den Milizionär herbei, welcher sich im Nachbarraum befand. Wir gingen den Weg bis zum Untersuchungsgefängnis zurück, nun allerdings mit vertauschten Plätzen – jetzt ging er vor mir und ich hinter ihm. Zum letzten Mal öffnete der Milizsoldat unsere Zelle, wo mein !Advokat“ mich zur Freilassung beglückwünschte und ich ihm zur gelungenen Verteidigung. Zum Dank überließ ich ihm all meine Lebensmittel und meine Seife. Stepanow wartete bereits auf mich. Ohne viel Aufhebens um die gescheiterte Angelegenheit zu machen und ohne irgendwelche Kommentare dazu abzugeben, gab er mir gemäß Liste meine konfiszierten Sachen zurück. Nachdem er mir scheinbar alles ausgehändigt hatte, sehe ich, dass der Füllfederhalter fehlt. Er bermerkte das und meinte: „Du brauchst ihn nicht suchen, ich habe ihn verloren, das ist ja kein großer Verlust!“ Ich erwiderte nichts, denn ich war heilfroh,dieses schreckliche, zweigeschossige NKWD-Gebäude so schnell wie möglich wieder verlassen zu können. Trotzdem tat es mir um den deutschen, qualitativ hochwertigen Federhalter, den ich für meinen hervorragenden Abschluß der 7. Klasse in Moskau 1941 von Papas ältestem Bruder, Onkel Karl Iwanowitsch Petri (geb. 1875) bekommen hatte, unheimlich leid; der Onkel hatte mich nach der Verhaftung meines Vaters zu sich nach Moskau geholt, um mich bei sich aufzuziehen. Später sah ich den zum Trinker gewordenen Kommandanten auf einem Markt wieder, als er Rauchwaren und allen möglichen Kleinkram veräußerte, - die NKWD-Organe hatten ihn wohl wegen seines kriminellen Amtsmißbrauchs entlassen. Nach meiner Freilassung nahm mich die mir bekannte, herzensgute deutsche Schuster-Familie Roppeldt bei sich auf – bereits betagte Eltern mit einem Sohn namens Alfons und einer Tochter mit Namen Viktoria – beide in meinem Alter.
Die erste Oktoberhälfte des Jahres 1944 war bereits vergangen, es herrschte Winter, überall lag Schnee, und im Technikum würde schon sehr bald (am 15.) der Unterricht beginnen. Am folgenden Tag fuhr ich mit der Schmalspurbahn von Dudinka nach Norilsk. Für die 90 km brauchte sie 12 Stunden, denn die Schienenstrecke war durch zahlreciche Schneewehen versperrt, und die Passagiere, die sich in einem Waggon befanden, mußten sich aus dem ersten Güterwagen Brecheisen und Schaufeln zur Säuberung des Schienenweges holen. Es gelang uns, die kleine, aus den Schienen gesprungene Lokomotive mit hölzernen Hebestangen und Brecheisen wieder auf die Schienen zu setzen, und dann fuhren wir in dem heftig wütenden Schneesturm weiter. Es war kalt im Waggon, alle froren, denn die Fenster waren schlecht abgedichtet und der gußeiserne, mit Kohle beheizte Ofen schaffte es nicht, den Wagen zufriedenstellt zu beheizen. Unterwegs wurden wir einmal mit Wasser und Kohle versorgt.
Norilsk begrüßte die eingetroffenen Passagiere mit einer scharfen Kontrolle aller Dokumente durch die Tschekisten, denn wir waren in einer Lagerzone dicht beieinander lebender „Volksfeinde“, mit einem Kontingent von 75000 Häftlingen mit Haftzeiten von 10 bis 30 Jahren, angekommen. Mein „weißer Paß“ (das Ausweispapier eines Sondersiedlers, das von der Kommendantur ausgestellt worden war), sowie die Einladung zum Studium am Technikum riefen bei den Kontrolleuren keinerlei Einwände hervor. Ich begab mich auf der Straße zum Technikum (es herrschten etwa 20 Grad Frost), zu deren beiden Seiten sich dichtgedrängt die Konzentrationslager mit ihren mit Stacheldraht eingezäunten Baracken und den Wachtürmen befanden. Inmeinem Gedächtnis ist ein Bild erhalten geblieben, das ich danach mein Leben lang nie wieder sah: in der Lagerzone lagen, in gleicher Höhe mit den Baracken, zwei Kleiderhaufen – einer mit den Uniformen deutscher Soldaten, der andere – mit ihren Schuhen. In beiden Haufen krochen wie Ameisen Häftlinge herum, um sich Sachen entsprechend ihrer Kleidergröße herauszusuchen. Bei der empfindlichen Kälte waren die Gefangenen in großer Eile, denn sie waren nur halb bekleidet, das heißt sie trugen lediglich ihre Unterwäsche. Das nannte sich „Selbstbedienung bei der Versorgung von Häftlingen mit Industriewaren“.
Das Technikum befand sich in einem zweistöckigen Lehrkomplex und besaß für die Studenten zwei von der Lagerzone durch Stacheldrahtzäune abgegrenzte Baracken. Jede Baracke war, je nach Spezialgebiet, für 25 Studenten bestimmt: Bergbau und die Verhüttung von Buntmetallen. In jeder Baracke standen 25 Eisenbetten (die Gefangenen schliefen auf doppelstöckigen Pritschen), zwei Ziegelofen sowie ein Waschbecken mit zehn Hähnen des weiteren gab es einen Gemeinschaftskleiderständer, an jedem Bett einen Nachttisch und einengemeinsamen Tisch zur Erledigung der Hausaufgaben. Die Registrierung aller eingetroffenen Studenten wurde vom stellvertretenden Direktor des Technikums, Akulow, durchgeführt. Ich geriet als zukünftiger „Spezialist für Buntmetalle“ in die zweite Baracke. In der Kantine wurde für uns dreimal täglich die Ausgabe einer guten Verpflegung organisiert. In der ersten Unterrichtsstunde lernten wir unsere Mathematik- und Physiklehrer kennen. Ihre Augen strahlten vor Glück, dass sie, wie in früheren Jahren, als es die Häftlingslager noch nicht gab, junge Menschen vor sich sahen – Studenten, denen sie nun hier am Technikum die Grundlagen der Wisschenschaften auf Hochschulniveau beibringen wollten, denn ihre Kenntnisse, die sie als Akademiker und Professoren an den Universitäten der Hauptstadt erworben hatten, konnten sie doch nicht einfach auf das Niveau von Mittelschulen sinken lassen. Das Technikum befand sich unter behördlicher Unterstellung (d.h. es war dem Norilsker Kombinat angeschlossen), und besaß deshalb ein Unterrichtsprogramm, das seinen Interesssen und Möglichkeiten entsprach. Und die waren maximal – Lehrkräfte mit höchstem Bildungsniveau; gerade sie waren während der Diktatur des Proletariats, wie wir wissen, als „Volksfeinde“ in Erscheinung getreten. Sie waren Autoren bekannter Bücher und Lehrbücher aus verschiedenen Bereichen der Wissenschaft und Technik, man lauschte ihren Vorlesungen mit angehaltenem Atem, schrieb Wort für Wort mit, denn es gab überhaupt keine Lehrbücher oder nur vereinzelte Ausgaben, welche die zahlreichen Studenten sich dann miteinander teilen mußten.
Die Woche verging für mich wie im Traum, ich war in eine neue, langersehnte Welt eingetreten, die Welt der Wissenschaft, die Welt großartiger Menschen und Denker. Nach einigen Tagen des Lebens in der Baracke fühlte ich, dass ich von Läusen befallen war – und zwar massenhaft. Während der Unterrichtsstunden merkte ich, wie sie mir den Hals hinauf hinter die Ohren krochen, und ich zerquetschte sie, ohne dass meine Nachbarn es merkten. Ich denke, dass die Läuse vom allgemeinen Kleiderständer für die Oberbekleidung auf meine Sachen umgezogen waren. Seife besaß ich nicht, denn die hatte ich ja im Gefängnis von Dudinka meinem Zellennachbarn geschenkt. Allerdings wurde dieses ganze Läuseproblem zum Ende der Unterrichtswoche recht schnell und einfach durch Akulow gelöst, der mich aus dem Technikum hinauswarf, sobald er erfahren hatte, dass ich Deutscher war. Es war nämlich so, dass jeder Sowjetmensch damals zu Kriegszeiten beim Umzug an einen anderen Wohnort verpflichtet war, eine Bescheinigung laut Formblatt N° 7 vorzuweisen, dass er an dem und dem Tag des betreffenden Monats seine Lebensmittel- und Industriewarenmarken abgegeben hatte; dafür sollte er dann am neuen Wohnort neue Marken erhalten. Als Fischer hatte ich mich in einer sogenannten zweckgebundenen Versorgungslage befunden und hatte deswegen keine monatlichen Marken, sondern aufgerollte Bezugsscheine im Gegenzug für den abgelieferten Fisch erhalten. Akulow war aufgefallen, dass ich ihm kein Formblatt N° 7 ausgehändigt hatte, und rief mich daher zu sich ins Kabinett. Ich erklärte ihm alles. Da fragt er mich: „Wie bist du denn ins Tajmyr-Gebiet geraten?“ – Ich antwortete, dass man mich dort 1942 als Sondersiedler abgeliefert und ich dort als Fischer gearbeitet hätte. „Warte mal – und welcher Nationalität bist du?“ – Ich erwiderte, dass ich ein aus Moskau stammender Deutscher sei. „So-so, Petri, ein Technikum für Deutsche haben wir nicht vorgesehen. Du kannst gehen!“ – Als ich das Kabinett verließ, bemerkte ich, wie er in die Liste unser Gruppe neben meinen Nachnamen ein Kreuzzeichen setzte. Am Morgen erging dann der erlogene, aufgrund meiner Nationalität erfolgte Befehl „ ... L.O. Petri auf eigenen Wunsch aus dem Technikum zu entlassen“. Die Studenten sahen diese Anordnung und sagten mir, dass das Betrug sei – eine illegaler Ausschluß. Sie gaben mir den Rat, mich an die Norilsker Staatsanwaltschaft zu wenden. Der Staatsanwalt sagte mir genaus dasselbe wie Akulow (der hatte offenbar in einem Telefonat die Staatsanwaltschaft verständigt, denn der Staatsanwalt antwortete mit genau den gleichen Worten, die ich auch schon im Technikum vernommenhatte): „Fahr in deine Kolchose zurück, Petri! Für Deutsche gibt es bei uns kein Technikum!“ Von allen 50 Studenten war ich der einzige deutsche Sondersiedler an dem Technikum, in dem ich eingeschrieben war, das mich angenommen und in dem ich mein Studium begonnen hatte; daher konnte die Rede gar nicht von den Deutschen im allgemeinen sein, sondern lediglich von einem einzigen Studenten, der in diesen „Technikumsaufbau“ nicht hineinpaßte. Aber damals herrschten solche Zeiten, in denen die Gesetzlosigkeit zur unmittelbaren Politik des Staatsapparates gehörte.
Vor meiner Fahrt nach Dudinka beschloß ich, mich in Norilsk noch einmal ins Badehaus zu begeben, um die Läuse loszuwerden. Da ich keine Seife besaß, wollte ich versuchen, mich mit Hilfe von Asche zu waschen, aber ich fand keine Holzasche – in den Häusern gab es nur Steinkohlenasche. So wusch ich mich dann mit heißem Wasser, dessen Temperatur ich gerade eben aushalten konnte; die Asche zeigte keinerlei Effekt, allerdings durchlief meine Kleidung eine Dampinfektion,und für die Haare hätte ich einen besonders feinen Kamm benötigt, den ich jedoch nicht besaß. Ich fuhr anschließend nicht in die Kolchose, sondern nur bis Dudinka, wo mir meine gutherzigen Alterchen mit einem solchen Kamm, einem richtigen Seifenbad und einer erneuten Dampfreinigung meiner Kleidung behilflich waren, meine „Weggefährten“ auf immer und ewig los zu werden. Zusammengefaßt kann man sagen, dass Akulow mich mit seinem Kreuzchen auf einen Schlag von zwei meiner Probleme erlöste – dem Ungeziefer und der Ausbildung. Ich war schrecklich gekränkt wegen des ungerechten Verlusts meiner Verbindungen zur Wissenschaft, dem geistigem Schaffen und dem Kontakt zu großartigen, klugen Menschen. Und wenngleich ich in puncto Bildung aufgrund meiner Nationalität ein politisches Opfer war, so blieb doch die Entwicklung nicht stehen – es ging trotz allem immer vorwärts.
Der uns bereits bekannte Major Owtschinnikow erteilte mir die Erlaubnis in Dudinka zu bleiben und dort zu arbeiten, indem er auf mein Gesuch hin eine Resolution schrieb: „An den Kommandanten von Dudinka. Petri ist hier anzumelden“. Ich habe keine Ahnung, weshalb ihm mein Gesuch gefiel; wie ich mich jetzt erinnere, mag es am Freispruch des Gerichts in Dudinka gelegen haben, aber jedenfalls erwies er sich mir gegenüber als gefällig. Das war damals für mich ein großer Sieg über die mich allseits umgebende Ungerechtigkeit – das Strafverfahren und der Ausschluß aus dem Technikum. Im Technikum hatten sie mich ziemlich schnell „entlarvt“. Und trotzdem – wenn man mit 18 Jahren einen Sieg verspielt hat, dann bedeutet das noch keine Tragödie fürs ganze Leben!
Das Leben in Dudinka setzte sich ab November 1944 mit der Fortsetzung meiner Freundschaft mit Jurij Jankowitsch fort, mit dem ich im Jahre 1942 zusammen durch heftigsten Sturm un einem Boot auf dem Jenisej unterwegs gewesen war, um für die hungernde Brigade Lebensmittel zu holen. Heute lebt er in Riga und ich in Hamburg, aber unsere bereits in der Jugendzeit begonnene Freundschaft hat sich bis zum heutigen Tage erhalten. In Dudinka also machte ich Jurij ausfindig, der als Leiter einer Zehnerbrigade und Normsachbearbeiter beim Bau tätig war, und bat ihn, mir eine Arbeit zu besorgen. Er machte mich mit dem Direktor der Umladestation der staatlichen Tajmyrer Fischgenossenschaft Sabrodin bekannt, der mich am folgenden Tag zum Leiter der Kaderabteilung des Konzerns Knjasew brachte. Nach allem zu urteilen, war man bereit, mir entgegen zu kommen und stellte mich als Lehrling in der Planabteilung ein, weil ich Astrachaner war; schließlich bestand das gesamte Kollektiv und auch seine Leitung aus Spezialisten der astrachaner Fischindustrie, die 1942 nach Igarka und später ins Tajmyr-Gebiet, zur Organisation des Staatlichen Tajmyrer Fischfangkonzerns“ und seinen Unternehmen (Fischfabrik, Fischfangflotte und Transportwesen) geschickt worden waren. Mein Chef wurde der Leiter der Planabteilung Bolkow, ein qualifizierter Spezialist und Wirtschafter, ein gutmütiger und fleißiger Mann. Mein regelmäßiges Gehalt betrug 400 Rubel (abzüglich Kriegs-, Kinderlosen- und Einkommen-Steuer); bar auf die Hand bekam ich 250 Rubel, die mit Müh und Not für den Bezug von Lebensmittelkarten für Beamte ausreichten.
Ich aß in der Kantine, in der ich alle Lebensmittel- und Brotmarken abgab. Während des gesamten Jahres,in dem ich meine Mahlzeiten in der Kantine einnahm, litt ich ständig an Hunger und dachte ununterbrochen ans Essen. Zur Zeit des Krieges, des Lebens im Tajmyr-Gebiet, in Sibirien und in den Studienjahren war dies der einzige Fall, wo ich ein ganzes Jahr lang hungerte. In der Tat, ein Stückchen Brot und ein Teller Gemüsesuppe, in der nicht alles schwamm, was darin hätte sein sollen, stellten keine normale Mahlzeit für einen jugendlichen Organismus dar. Aber woanders konnte ich nicht hin. Und obwohl der Magen leer war, gingen Witja und ich jeden Samstag zum Tanzen in den Hafenklub. Nach drei Monaten versetzte man mich auf den Posten eines Berechnungswirtschafters mit einem festen Gehalt von 600 Rubel. Jetzt konnte ich es mir schon erlauben, im Laufe eines Monats zusätzlich auf dem Markt zwei Laibe Weißbrot und eine Halbliterdose Tafelbutter zu kaufen.
Die Arbeitsbedingungen und die einfach menschliche Atmosphäre im Kollektiv der Trust-Verwaltung waren sehr wohltuend, es gab keinerlei Anspielungen, dass ich zu den Sondersiedlern gehörte, unter Meldepflicht bei der NKWD-Kommandantur stand oder Deutscher war. Nach einigen Monaten wurde ich zum ersten Mal in die Gewerkschaft der Arbeiter in der Fischindustrie aufgenommen. Die Arbeit verlief einmütig und gut, als plötzlich der Oberingenieur des Trusts, Kurilo, ums Leben kam. Während des Fluges von Igarka nach Dudinka (etwa 400 km) geriet sein Flugzeug ein Zweisitzer vom Typ „Kukurusnik“ („Maispflücker“; Anm. d. Übers.) in einen heftigen Schneesturm. Pilot und Passagier (Kurilo) kamen ums Leben. Wie uns der Bevollmächtigte des Konzerns Loschtschilin mitteilte, hatte damals kein triftiger Grund vorgelegen, bei derart unbeständigem Wetter mit einem so kleinen Flugzeug zu fliegen. Es hätte durchaus die Möglichkeit bestanden, auf besseres Wetter zu warten und mit einer „Douglas“ den Flug nach Hause, nach Dudinka, anzutreten. Aber unser Hauptingenieur war ein aktiver Mensch, der keine unnütze Zeit verschwenden wollte. Das gesamte Kollektiv der Konzernverwaltung trauerte um den frühzeitigen Tod des großartigen Spezialisten.
Alle Astrachaner brachten mir viel Aufmerksamkeit entgegen; sie sahen, wie sehr ich mich bemühte, meine neuen Bekanntschaften als professionelle Schule zu nutzen. Sie waren für mich wie Lehrer. Nachdem ich alle Abteilungen durchlaufen und vielen Gesprächen über Produktionsthemen gelauscht hatte, begann ich die für mich neue Arbeit zu bewerten und anzuerkennen. Besonders gut freundete ich mich mit dem Leiter der produktionstechnischen Abteilung Jerschow an, einem erfahrenen Ingenieur und guten Ratgeber in vielen Fragen und Problemen.
Ein halbes Jahr lebte ich bei der Familie Roppeldt, wofür ich ihnen noch heute dankbar bin, und dann, im Mai 1945, holte mich der Leiter der Rundfunkstation des Konzerns, Konstantinow, zu sich, mit dem ich einträchtig zusammenwohnte, bis meine Mutter aus dem Norilsker Konzentrationslager zu mir kam. Da stellte mir der Konzern auf dem Dachboden ein kleines Zimmer zur Verfügung, hinter dessen Bretterverschlag noch ein junges Paar wohnte. Das elektrische Licht war spärlich – es gab nur eine rote Glühbirne, die Küche wurde gemeinschaftlich mit den Nachbarn genutzt.
Vom Tag des Sieges erfuhr ich auf dem Weg zur Arbeit, als ich mich dem Konzerngebäude näherte und plötzlich vom hohen Flügel den Ruf höre: S-I-I-I-E-G!!! Um 13 Uhr findet eine Versammlung statt! Der Platz im Zentrum von Dudinka ist überfüllt mit Menschen, auf der schnell errichteten, mit rotem Stoff ausgekleideten Bühne standen sämtlich Regions- und Stadtherren, einschließlich des uns bekannten „Freundes“ Mikow. Ein Blasorchester spielte. Die Menschen jubelten, ein Traum war Wirklichkeit geworden – der Sieg! In der Zeitschrift „Dudinka“ N° 2 vom Mai 2002 gab es eine Fotografie von dieser Versammlung, auf der auch ich zu sehen war.


Im Herbst 1945 ergab sich für mich die zweite große Freude, als nämlich in
Dudinka die Abendschule der Arbeiterjugend eröffnet wurde. Alle meine Freunde
aus den Reihen der Sondersiedler und auch ich meldeten sich inder Schule an.
Viktoria und ich mußten noch die achte Klasse absolvieren. Es kam eine
glückliche, aber auch mühsame Zeit mit täglichem Schulunterricht von 18 bis 22
Uhr – immer nach der Arbeit. Mit Lehrbüchern und schöngeistiger, klassischer
Literatur verhielt es sich äußerst schwierig – es gab eine lange Warteschlange
für einzelne Bücher, die man auch nur für eine einzige Nacht ausleihen konnte.
Die Lehrkräfte waren qualifizierte Spezialisten, unter ihnen vor allem
herausragende, einst repressierte Ingenieure mit den Fachbereichen Mathematik
und Physik, die vor ihrer Verhaftung in Moskau und Leningrad studiert hatten.
Der wesentliche Teil der Schüler in den vollständigbelegten Klassen bestand aus
Jugendlichen, die wegen des Krieges mehrere Schuljahre an der regulären
Tagesschule verloren hatten. Für die Lehrer war das Arbeiten mit Lehrbüchern
schwierig, weil die Schüler auf einem ganz unterschiedlichen Wissensniveau
standen. Besonders weit zurück waren Frontsoldaten, die lediglich
Dorfschulbildung besaßen.
Die Fremdsprache (Deutsch) mußten sie von Grund auf erlernen.
Aber dieses alltägliche Glück währte nicht lange – im April 1946 wurde der Staatliche Tajymrer Fischkonzern liquidiert und ich stand ohne Arbeit da. Unsere komplette Planungsabteilung (5 Mann), mit Ausnahme von Leiter Wolkow, waren gezwungen in Dudinka zu bleiben, denn wir standen noch unter NKWD-Kommandantur, als die Astrachaner bereits an die Wolga zurückkehren durften. Aber erneut, nun schon zum zweiten Mal, war mir die Familie Jankowitsch bei der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz behilflich. Die Ärztin Natalia Viktorowna brachte mich mit einem ehemaligen Häftling zusammen, der in der Planungsabteilung der Dudinsker Hafenverwaltung des Norilsker Bergbau- und Hüttenkombiants des NKWD der UdSSR beschäftigt war, und der wiederum machte mich mit seinem Chef Rosanow (ebenfalls ein ehemaliger Gefangener) bekannt, der mich in die Planungsgruppe der Hafenabteilung für Wassertransportwesen schickte, die von dem Häftling Solowjow aus Leningrad geleitet wurde, der seinerzeit im „Fall Kirow“ aufgrund des Paragraphen „Mitglied einer trotzkistischen Organisation“ verurteilt worden war. Unsere Planungsgruppe sowie die gesamte Abteilung für Wassertransportwesen befand sich in der Zone der 4. Lagerabteilung, zu der man mit einem Passierschein Zutritt erlangte, denn wir arbeiteten mitten unter den Gefangenen - aus politischen Motiven verurteilten „Volksfeinden“. Dieses Durchgangslager durchliefen zu Stalins Zeit zahlreiche bekannte Leute, wie beispielsweise einer der ersten Entdecker von Bodenschätzen in Norilsk – Urwanzew, der Schriftsteller Garri, der Gelehrte und Historiker Gumilew, die bekannten Schauspieler Smoktunowskij und Schschenow, der erste Sekretär des Zentralkomitees des Allrussischen Leninistisch-Kommunistischen Jugendverbandes Miltschanow. Im Hafen arbeitete die Tochter des erschossenen Sekretärs des Zentralkomitees des Allrussischen Leninistisch-Kommunistischen Jugendverbandes – Kosarewa, die zusammen mit ihrer Mutter als Familienmitglied eines „Volksfeindes“ ins Tajmyr-Gebiet verschleppt worden war. Auch die berühmte, in aller Welt bekannte Ballerina Uljanowa entging dem Lager nicht. Auch Suratows komplettes Jazzorchester war im Lager. Aufgrund von erlogenen Denunziationen brummte Stalin jedem seiner Mitglieder 10 Jahre dafür auf, dass sie angeblich im Restaurant des Hotels „Metropol“ im Zentrum Moskaus ein Programm für den Fall des Zusammenbruchs der Stadt Moskau im Jahre 1941 vorbereitet hatten. Aber jedenfalls wurden sie im Lager nicht für irgendwelche ungelernten Arbeiten eingeteilt, sondern musizierten dort weiter, indem sie Konzerte im Haus der Ingenieuere und Techniker in Noirlskund im Klub von Dudinka gaben. Damals herrschte in unserer Lagerabteilung das Häftlingsgebot: „Vertraue niemandem, fürchte dich nicht und bitte um nichts....“.
An der Spitze der Abteilung Wassertransportwesen stand der talentierte Ingenieur und Schiffbauer und ehemalige Gefangene Rasin aus Leningrad; als Oberbuchhalter arbeitete dort der ehemalige Hauptbuchhalter der Rostower Dampfschifffahrtsgesellschaft – Häftling Chitrin, als Hafenkapitän der hochqualifizierte Schiffsführer der Reedereiflotte Birdjugin, als Dispatcher der Reedereiflotte der ehemalige moskauer Conferencier – Häftling Filipow; als weiterer Dispatcher der Reedereiflotte der ehemalige erste Steuermann des Schiffs „KIM“, das Tschkalows Flugzeug aus den USA (er war in einem Nonstop-Flug über den Nordpol dorthin geflogen) nach Odessa gebracht hatte – Häftling A. Wainstein. In der Leitung der Hafenverwaltung saßen: Verwaltungsleiter Schuk, später Ksintaris, der Sekretär des Parteikomitees Gurewitsch, der Hafendispatcher und Häftling Macharadse. Großen Eindruck von sich hinterließ ein hochgebildeter, kultivierter Mann und Spezialist in Sachen Seefahrt, der hervorragend Englisch sprach - der Kapitän auf großer Fahrt Georgij Osipowitsch Kononowitsch, mit dem ich mich anfreundete. Er war es, unter dessen Kommando 1947 zum Zwecke der Kriegsentschädigung eine ganze Schiffskarawane, mit dem Eisbrecher „Tajmyr“ an der Spitze, von Finnland nach Dudinka gebracht wurde. Später wurde Kononowitsch Kapitän und Lehrherr auf dem atombetriebenenEisbrecher „Lenin“ sowie Kapitän auf dem Stückgutschiff „Swenigorod“ auf der Route Murmansk – Kanada.
In eine solche Umgebung ehemaliger, gegenwärtiger, großer und talentierter Leute war ich also geraten. Dies war nach Ust-Chantajka und dem Staatlichen Tajmyrer Fischkonzern nun meine dritte „Universität“. Gemäß Stellenplan ernanntensie mich zum Techniker in der Planungsgruppe mit einem Gehalt von 1000 Rubel. Mit einem derart hohen Verdienst hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Das konnte sich nur der Hafen als Unternehmen der Norilsker NKWD-Behörde leisten. Jetzt waren Mama und ich sowohl in finanzieller Hinsicht, als auch in puncto Lebensmittel abgesichert, denn mit Hilfe der „norilsker“ Lebensmittelmarken konnte man eineinhalbmal so viele Lebensmittel beziehen, als zuvor mit den „dudinsker“ Karten.
In der Abteilung Wassertransportwesen, die vorher außerhalb der Zone der 4. Lagerabteilung, im ersten Stock des Nachbarhauses zusammen mit der Hafenverwaltung untergebracht gewesen war, konnte ich nach der Arbeit schön meine Hausaufgaben erledigen. So verrannen mit Arbeit und Studium ganz schnell drei Jahre, und nachdem ich 1948 die Mittelschule beendet hatte, erhielt ich aufgrund des Mangels an Vordrucken für das Reifezeugnisse eine einfache Bescheinigung über meinen Abschluß der 10. Klasse. Diese Bescheinigung mußte in der Stadt Krasnojarsk in der Regionalen Abteilung für Volksbildung gegen ein richtiges Reifezeugnis umgetauscht werden. Ich wollte damals so gern Schiffbauer werden (den Grundstein dafür hatte ich bereits im Pionierpalast in Astrachan gelegt); deswegen händigte mir Schuldirektor Kulik vier Exemplare der Bescheinigung aus, die ich an verschiedene Schiffbau-Hochschulen (in Astrachan, Gorkij und Leningrad) versandte, in der naiven Annahme, dass man mich, einen Deutschen, zu Stalins Zeiten annehmen würde. Natürlich erhielt ich drei Absagen. Die vierte Bescheinigung tauschte ich später bei der Regionalen Abteilung für Volksbildung ein. Um einen Studienplatz am Sibirischen Institut für Technologie zu erhalten und in Witjas Nähe sein zu können, beschlossen Mama und ich damals zur Familie Walter nach Krasnojarsk zu fahren. Die Erlaubnis zur Abfahrt aus Dudinka erteilte uns der Leiter der Tajmyrsker Sonderkommandantur Sisman.
Und dann, am 10. Juli 1948, verließen Mama und ich mit dem Motorschiff „J. Stalin“ das Tajmyr-Gebiet.
Im weiteren Verlauf kamen dann das Studium, die Arbeit und die Liebe.
Greifen wir nun 72 Jahre vor, in eine Zeit, als wir bereits in Hamburg leben.
Es gibt eine Neuigkeit! Soeben (am 29. August 2010) sind meine Landsleute, die Familie Weber, von einem Gastaufenthalt in Dudinka nach Hamburg zurückgekehrt. Von Irma Scherer (s. S. 34) und anderen Augenzeugen haben sie erfahren, dass unser Gedenkkreuz in Ust-Chantajka „gesund und munter“ und von den auf dem Jenisej vorbeifahrenden Schiffen aus gut zu sehen ist. Aus Potapowo (70 km) kümmern sich Alekander Wakker und Konstanin Kochs Familie ständig um die „Gesundheit“ unseres zehn Meter hohen Metallkreuzes, welches die Erinnerung über die tragischen Ereignisse der dort in den Jahren 1942-1944 deutschen Menschen fest bewahrt. Familie Weber brachte sich ein Geschenk von Irma Scherer mit – ein uraltes Buch, und für mich, als ehemaligem Fischer der Jahre 1942-44, einen geräucherten Weißlachs, den besten Fisch, den is im Tajmyr-Gebiet gibt. Vielen Dank, ihr Lieben, für die bekundete Aufmerksamkeit und Sorge. Dies ist die gute Neuigkeit, die unsere Tajmyrer „vollbracht“ haben. Wir werden mit den Augenzeugenberichten unserer „Sonder......“ fortfahren.